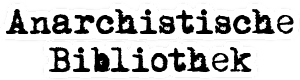Nicolas Walter
Orwell und die Anarchisten
George Orwell starb 1950. Mit der Veröffentlichung von Farm der Tiere war er 1945 berühmt geworden, und diese Berühmtheit wuchs durch die Publikation von 1984 im Jahre 1949 noch beträchtlich. Jedoch, schon zu krank, konnte er seinen Ruhm nicht mehr genießen; er starb im Alter von 46 Jahren an Tuberkulose. Seitdem ist er immer bekannter und berühmter geworden, und heute kennt ihn, der schon zu Lebzeiten ein Klassiker geworden, praktisch jeder, der überhaupt liest. Fast alle seine Bücher werden immer wieder neu aufgelegt, und die meisten seiner Kurzgeschichten sind in den vierbändigen Gesammelten Werken [1] (Collected Essays, Journalism und Letters) abgedruckt. Von allen Werken moderner Schriftsteller lassen sich die seinen am leichtesten beschaffen, und sie zählen auch zu den „problemlosesten", denn Stil und Struktur aller Arbeiten Orwells sind sparsam und einfach, ihr Zweck und ihr Charakter sind von so eigener Art und so kraftvoll, daß Einführung und Erklärung praktisch überflüssig sind. Von daher gibt es in gewisser Weise eigentlich keine Notwendigkeit, überhaupt irgendetwas über Orwell zu lesen; es reicht, ihn zu lesen. Dennoch hat dies viele Leute nicht daran gehindert, über ihn zu schreiben.
Es gibt zahlreiche Studien über seine Arbeiten, aber nur wenige sind wirklich von Nutzen — die meisten schlicht überflüssig. Orwell selbst verlangte, es solle keine Biographie geschrieben werden und mehr als zwanzig Jahre lang erschien auch keine.[2] Dann aber erschien eine Vielzahl von Studien über sein Leben, wobei das wertvollste Material die persönlichen Erinnerungen einiger Leute, die ihn gekannt haben, sind; nahezu der ganze Rest ist wertlos und überflüssig. Abgesehen von blanker Unkenntnis der Materie bestand ein wesentliches Problem immer darin, daß Orwells Frau, die er kurz vor seinem Tod geheiratet hatte und die sowohl das Copyright für seine Arbeiten als auch seinen schriftlichen Nachlaß kontrollierte, sich weigerte, einen vollständigen Abriß seines Werkes mit allen dafür nötigen Zitaten zu erlauben oder eine entsprechend umfassende Darstellung seines Lebens mit all den unerläßlichen Informationen zu versehen. Diese unerfreuliche Situation änderte sich 1972, als der erste Band einer auf insgesamt zwei Bände angelegten Studie über Orwells Leben von Peter Stansky und William Abrahams erschien. Diese Studie, gleichzeitig detailliert und schrecklich, erreichte, daß Sonia Orwell eine ordentliche Biographie autorisierte, und zwar durch Bernard Crick, Professor für Politik am Birkbeck College in London und ein bekannter demokratischer Sozialist und literarischer Journalist.
Das Ergebnis, das acht Jahre später als George Orwell: A Life veröffentlicht wurde, ist das bisher bei weitem beste Buch über Orwells Leben und Karriere. Entscheidender Vorteil Cricks war, daß er als erster die völlige Freiheit hatte, sowohl aus Orwells gesamten publizierten als auch unpublizierten Schriften zu zitieren, und daß er Zugang zum gesamten Orwell-Archiv im University College in London [3] hatte. Von daher ist sein Buch auf einer sehr viel breiteren Materialbasis aufgebaut als irgendein früheres. Ein weniger offensichtlicher, aber in gleicher Weise zu berücksichtigender Vorteil ist, daß er selbst viele der Charaktereigenschaften Orwells besitzt und seine politischen Ideen teilt; er ist mit dem Menschen Orwell und seinem Werk sehr gut vertraut. Cricks Arbeit kann sicherlich als Standardbiographie gelten, wenn auch Stanskys und Abrahams Darstellungen von Orwells Leben bis 1938 (Der unbekannte Orwell [The Unknown Orwell], 1972 und Orwell: Die Verwandlung [Orwell: The Transformation], 1979) zweimal so umfangreich sind und sie auch einige Quellen benutzt haben, die ihm wohl nicht zur Verfügung standen.
Das Buch George Orwell: A Life wurde nach seiner Veröffentlichung im November 1980 ausgiebig rezensiert; mit weiteren allgemeinen Kommentaren ließe sich jetzt und hier nichts mehr gewinnen. Aber es ist interessant und möglicherweise auch nützlich, einen speziellen Aspekt aus Orwells Leben und Werk näher in Augenschein zu nehmen, der wenig bekannt ist, aber durch die Publikation von Cricks Biographie deutlicher wird als vorher: seine Beziehungen zum Anarchismus und den Anarchisten. In einem Fall wie diesem — und es gibt selbstverständlich eine ganze Reihe vergleichbarer, darunter Shelley, William Morris, Oscar Wilde, Edward Carpenter, E. M. Forster, Herbert Read — hat es keinen Sinn, sich zu sehr in eine Richtung oder auf einen Standpunkt festzulegen: entweder zu behaupten, Orwell sei im Grunde immer Anarchist gewesen, oder, er habe nie etwas mit dem Anarchismus zu tun gehabt. Den ersten Fehler begeht zum Beispiel Julian Symons, der Schriftsteller, der während des 2. Weltkriegs eng mit den Anarchisten liiert war und der bis heute dem Anarchismus wohlgesonnen blieb, der darüberhinaus ein enger Freund Orwells war. In einem Artikel im London Magazine (September 1963) lenkte er zum ersten Mal die Aufmerksamkeit auf Orwells seinerzeitige Verbindung zu und Verbundenheit mit den Anarchisten; aber im weiteren behauptet er dann, Orwell habe auch für den Rest seines Lebens den libertären Sozialismus unterstützt, und diese Idee sei „für ihn in den Persönlichkeiten der undogmatischen Anarchisten viel sympathischer zum Ausdruck gekommen als in den dogmatischen Sozialisten, die das Gros der britischen parlamentarischen Labour Party ausmachten“.
Der Schriftsteller George Woodcock, der mit den Anarchisten während und nach dem Krieg verbunden und auch ein enger Freund Orwells war, umschreibt diese Sicht in seinem Buch The Crystal Spirit (1967), das die bisher zufriedenstellendste Studie von Orwells Werk ist, als „im wesentlichen korrekt“. Er stellt fest:
„Konservatismus und Sozialismus bilden die beiden Pole von Orwells politischem Denken. Was sie zusammenhält, ist der niemals ganz aufgegebene Hang zum Anarchismus... Anarchismus wahrte eine ruhelose Präsenz in seinem Denken bis zum Ende.“
Mit Hilfe von Cricks Buch läßt sich nun diese „Präsenz" vom Anfang bis zum Ende verfolgen.
Gerade bei Orwell ist es immer wichtig, mit den Anfängen zu beginnen, da er selbst viel von seinen Inspirationen und Ideen aus der eigenen Kindheit bezog – oder zumindest aus dem, was er aus seiner Kindheit machte. Seine Äußerungen über sein frühes Leben zu Hause oder in der Schule wecken oft Widerspruch in den Erinnerungen von Mitgliedern seiner Familie oder von Freunden, aber soviel ist klar, daß die Zeitgenossen sich des jungen Eric Blair in Eton als eines führenden Mitglieds einer „antinomischen" Partei erinnern, die alle religiöse und politische Orthodoxie verwarf; und daß seine Kollegen in der burmesischen Polizei ihn als unzufriedenes Mitglied des britischen Establishments erlebten, angewidert von sozialen und nationalen Vorurteilen. Orwell selbst bemerkt in der politischen Autobiographie, die die zweite Hälfte seines ersten erfolgreichen Buches The Road to Wigan Pier (1937) ausmacht, er sei bereits zu der Zeit, als er 1921 Eton verließ, „gegen jede Autorität“ gewesen und habe 1928 beim Verlassen Burmas „eine anarchistische Theorie ausgearbeitet [gehabt], daß jede Regierung von Übel ist, dass die Strafe immer mehr Schaden anrichtet als das Verbrechen und daß man den Menschen zutrauen kann, sich anständig zu benehmen, wenn man sie nur läßt“ – nur um dann unmittelbar und charakteristischerweise hinzuzufügen, daß „dies selbstverständlich sentimentaler Unsinn war“. Und doch war, aus einer leicht abweichenden, zunehmend persönlichen Perspektive, dies seine Position, als er zum ersten Mal als Schriftsteller hervortrat:
„Ich hatte alles auf die einfache Theorie reduziert, daß die Unterdrückten immer recht und die Unterdrücker immer unrecht haben: eine irrige Theorie, aber das natürliche Ergebnis der eigenen Zugehörigkeit zu den Unterdrückern. Ich fühlte, daß ich nicht einfach nur dem Imperialismus zu entrinnen hatte, sondern jeder Form der Herrschaft von Menschen über Menschen. Ich wollte mich selbst unterdrücken, geradewegs nach unten unter die Unterdrückten gelangen, einer von ihnen und auf ihrer Seite sein gegen ihre Tyrannen."
Falsches Bewußtsein, vielleicht, und doch eine Form von Bewußtsein, die besser als Bewußtlosigkeit und die einer Entwicklung fähig ist. Deshalb — auf einer persönlichen Ebene — die Abenteuer als Tramp oder Auf-den-Hund-Gekommener, die in einigen seiner frühesten und besten Arbeiten so lebhaft beschrieben sind. Ein paar Jahre später, im Begriff, sich seinen Weg in den linken Journalismus in London zu bahnen, umschrieb er sich selbst, wie es scheint, als „konservativer Anarchist (Tory anarchist)" — so erzählen es seine Freunde Rayner Heppenstall (in Vier Abwesende [Four Absentees], 1960 und Richard Rees (in George Orwell: Flüchtling aus dem Lager des Sieges [George Orwell: Fugitive from the Camp of Victory], 1961), obwohl es scheint, daß er, wenn er seine politische Position öffentlich definierte, immer mit irgendeiner Art von Sozialismus gleichgesetzt wurde.
Die wichtigste Entwicklung in Orwells politischen Anschauungen erfolgte in der Mitte seines dritten Lebensjahrzehnts. Das erste Ereignis war 1936 seine Reise in den Norden Englands, um für sein Buch The Road to Wigan Pier Armut näher zu erforschen, das Buch, in dem er zum ersten Mal seine uneingeschränkte und unzweideutige Bindung an den Sozialismus zum Ausdruck brachte. Aber dabei handelte es sich um eine ganz besondere und eigene Art von Sozialismus — weder marxistisch noch fabianisch, nicht egalitär oder bürokratisch. Er begann mit der Annahme, das dem Sozialismus „zugrundeliegende Ideal“ sei „Gerechtigkeit und Freiheit“, und das „Kennzeichen des wahren Sozialisten“ sei der Wunsch, „Tyrannei gestürzt zu sehen“. Er wiederholte, daß „Sozialismus den Sturz von Tyrannei meint“, und von dieser Ausgangsposition aus konnte er schlüssig argumentieren, daß „jeder anständige Mensch, gleich, in welchem Maße Konservativer oder Anarchist vom Temperament her“,... „für die Etablierung des Sozialismus arbeiten“ muß. Dies war für den Rest seines Lebens Orwells politische Grundposition. Das Problem von unserem Standpunkt aus ist, daß eine solche Sicht wesentlich für Anarchismus ist, aber daß Anarchismus nicht unentbehrlich für eine solche Sicht ist.
Das zweite wichtige Ereignis in dieser politischen Entwicklung war seine Reise nach Spanien gegen Ende 1936, um den Bürgerkrieg vor Ort zu studieren und dann daran teilzunehmen. Dort hatte er es nicht mit halbherzigen anarchistischen Theorien oder dem sogenannten Tory-Anarchismus zu tun, auch nicht mit der relativen Armut der Depression, sondern mit echten lebendigen Anarcho-Syndikalisten, die kämpften, um eine soziale Revolution inmitten eines furchtbaren Krieges durchzusetzen, mit Nationalisten und Faschisten vor sich und Republikanern und Kommunisten in ihrem Rücken. Diese Erfahrung in Spanien überzeugte ihn, daß die zwei großen Feinde des Sozialismus Faschismus und Kommunismus [4] sind, und er betrachtete zum ersten Mal Anarchismus als ernstzunehmendes Thema.
Als Orwell im Juli 1937 nach England zurückkehrte, zuerst knapp dem Tod durch eine schwere Verletzung an der Front entronnen und dann nicht minder knapp der Verhaftung während der Säuberung der nichtkommunistischen Linken in Barcelona entkommen, war er einer der sehr wenigen Leute in diesem Land, die tatsächlich in Spanien gewesen waren und die die spanischen Revolutionäre, einschließlich der Anarchisten, verteidigten. Er wies darauf hin, daß „es fast unmöglich (ist), irgendetwas Gedrucktes zu bekommen, was zugunsten von Anarchismus und Trotzkismus spricht“ (Time & Tide, 5. Februar 1938), und er trug mehr als irgendjemand sonst zu dem Bemühen bei, diese Situation zu ändern.
Orwell war mit finanzieller Unterstützung der Independent Labour Party nach Spanien gegangen (wie auch schon einige Monate früher in den Norden Englands) und hatte deshalb auch in einer Einheit ihres spanischen Alliierten, des revolutionären marxistischen POUM gekämpft. Aber er schrieb privat an seinen Freund Jack Common: „Wenn ich die Situation besser verstanden hätte, hätte ich mich wahrscheinlich den Anarchisten angeschlossen“ (Brief vom Oktober 1937); und er schrieb öffentlich in seinem Spanienbuch Mein Katalonien (Homage to Catalonia), 1938: „Was meine rein persönlichen Vorlieben anging, so hätte ich mich gerne den Anarchisten angeschlossen.“ Zur gleichen Zeit betonte er, „die meisten der aktiven Revolutionäre waren Anarchisten“ (New English Weekly, 29. Juli 1937) und „die Anarchisten waren die wichtigste revolutionäre Kraft“ (Time & Tide, 31. Juli 1937). Sein persönlicher Einsatz für den Sozialismus war nahezu einer für den Anarchismus geworden. Tatsächlich bemühte sich Emma Goldman mit all ihren Kräften, Orwell für die Sache zu gewinnen — ein Punkt, den Crick nicht erwähnt. Sie überredete ihn, das Internationale Anti-Faschistische Solidaritäts-Komitee zu unterstützen, das sie 1938 als Frontorganisation aufgebaut hatte, und das brachte ihn in Kontakt mit Anarchisten außerhalb Spaniens. Weitere Unterstützer waren Libertäre wie Ethel Mannin, Rebecca West, John Cowper Powys und Herbert Read, der kurz zuvor infolge der Ereignisse in Spanien zum Anarchismus gekommen war. In diesem Milieu lernte er auch Vernon Richards kennen, der seit 1936 Spain & the World herausbrachte, und kam auf diese Weise auch in persönlichen Kontakt mit der "offiziellen" anarchistischen Bewegung in England.
Aber Orwell war immer noch ein ziemlich unbekannter Schriftsteller. Dafür, daß er einen revolutionären und libertären Standpunkt in bezug auf Spanien einnahm und besonders auch dafür, daß er die Art der Behandlung, die die übrige spanische Linke durch die Kommunisten [5] erfuhr, unmißverständlich hervorhob, wurde er von seinem Verleger Victor Gollancz und einem seiner Herausgeber, Kingsley Martin vom New Statesman, boykottiert: beide Mitglieder der, wie er es nannte, „kommunistischen Mafia" (Communist racket). Seine Artikel erschienen nur in kleinen Magazinen, und Homage to Catalonia war eines seiner erfolglosesten Bücher. Die erste Auflage von fünfzehnhundert Exemplaren war noch nicht verkauft, als er zwölf Jahre später starb, und ungeachtet einiger Kontroversen zur Zeit der Publikation wurde es mit anderen vergleichbaren Büchern von der Flut liberaler und marxistischer Historiographien geschluckt, die erst Jahrzehnte später yon aufrichtigen Schriftstellern wie Pierre Broué und Emile Temime, Burnett Bolloten und Noam Chomsky kritisch gesichtet wurde. Dennoch hatte Orwell einigen Wert für die Anarchisten selbst, wie Emma Goldman an Rudolf Rocker schrieb: „Zum ersten Mal, seit der Kampf 1936 begonnen hat, ist jemand von außerhalb unserer Reihen an die Öffentlichkeit getreten, die spanischen Anarchisten so zu zeigen, wie sie wirklich sind.“ (Brief vom 6. Mai 1938) Dafür allein schulden [sic] Anarchisten Orwell tiefen Dank.
Und doch ist es bezeichnend, daß Orwell, ungeachtet seiner sympathisierenden Einstellung, sich keiner spezifisch anarchistischen Organisation anschloß. Wie Crick zeigt, trat er bei seiner Rückkehr aus Spanien der Independent Labour Party und der Peace Pledge Union bei, unzweifelhaft in der Überzeugung, die dringendste politische Aufgabe seien Sozialismus und Frieden. In der Tat war sein Standpunkt für mehr als ein Jahr praktisch pazifistisch. In die gleiche Phase fiel sein erster Tuberkuloseanfall, der ihn von März 1938 bis März 1939 niederwarf und ihn zwang, erst in ein Sanatorium in Kent und dann nach Französisch-Marokko zu gehen. Die bemerkenswerteste Episode ereignete sich hier Anfang 1939, als er an Herbert Read „über eine Sache, die mich sehr beschäftigt“, schrieb:
„Ich glaube, es ist lebensnotwendig für diejenigen von uns, die dem kommenden Krieg Widerstand entgegensetzen wollen, zu beginnen, sich für illegale Antikriegsaktivitäten zu organisieren. Es ist ganz klar, daß jede offene und legale Agitation unmöglich sein wird — nicht nur, wenn der Krieg einmal begonnen hat, sondern schon, wenn er gerade bevorsteht; und daß wir, wenn wir uns nicht jetzt für die Herausgabe von Flugschriften usw. vorbereiten, völlig außerstand sein werden, das nachzuholen, wenn der entscheidende Augenblick kommt. Gegenwärtig gibt es beträchtliche Pressefreiheit und keine Einschränkung beim Erwerb von Druckerpressen, Papiervorräten usw. , aber ich glaube nicht für einen Augenblick daran, daß dieser Zustand andauert. Wenn wir keine Vorbereitungen treffen, finden wir uns möglicherweise zum Schweigen verurteilt und vollkommen hilflos, wenn der Krieg oder die Vorkriegsfaschisierungsprozesse anfangen...
Es scheint mir, das Vernünftigste wäre, die Dinge anzuhäufen, die wir für die Produktion von Flugschriften, Aufklebern usw. brauchten, sie an einem unverdächtigen Platz zu lagern und nicht zu benutzen, bis es notwendig wird. Dafür hätten wir Organisation und vor allem Geld — wahrscheinlich drei oder vierhundert Pfund — nötig, aber das sollte mit der Hilfe von Leuten, die man wahrscheinlich allmählich gewinnen könnte, nicht unmöglich sein.“ (Brief vom 4. Januar 1939)
Read muß abratend geantwortet haben, da Orwell ein paar Monate später wieder auf das Thema zurückkam:
„Ich stimme völlig zu, daß es irgendwie absurd ist, mit den Vorbereitungen für eine Untergrundkampagne zu beginnen, ohne zu wissen, wer sie und wozu durchführen wird, aber das Problem ist, daß man, wenn nicht im vorhinein einige Vorbereitungen getroffen werden, hilflos sein wird, wenn man zur Tat schreiten will, wie Sie es für früher oder später als sicher erwarten. Ich kann einfach nicht glauben, daß die Zeit, in der man eine Druckerpresse kaufen kann, ohne Fragen gestellt zu bekommen, ewig währen wird...“
Orwell erklärte, er erwarte sowohl von der konservativ dominierten Nationalen Regierung als auch von jeder in der nahen Zukunft gewählten Labour-Regierung, zum Krieg mit Nazi-Deutschland zu rüsten und daß es einen „Faschisierungsprozeß [geben werde], der zu einem autoritären Regime führt" , von rechts und links getragen; die einzige Opposition würde von den wirklichen Faschisten kommen und von „dissidenten Linken wie uns“, die „irgendeinen Zusammenschluß von Leuten, die sowohl gegen Krieg als auch antifaschistisch sind“, organisieren müßten.
„Ich habe meine Zweifel, ob es viel Hoffnung gibt, England vor dem Faschismus der einen oder anderen Art zu retten, aber es ist ganz klar, daß man kämpfen muß, und es scheint dumm, zum Schweigen verurteilt zu sein, wenn man stattdessen ordentlich Krach schlagen könnte; bloß weil man versäumt hat, im vorhinein einige Vorsorge zu treffen. Wenn wir Druckerpressen usw. an einem unverdächtigen Ort einlagerten, könnten wir anschließend vorsichtig ans Werk gehen, ein Vertriebssystem zusammenzukriegen, und dann könnten wir das Gefühl haben: 'Gut, wenn es jetzt Ärger gibt — wir sind gerüstet.' Auf der anderen Seite, wenn es keinen gäbe, wäre ich so froh, daß ich über ein wenig vergeudete Mühe nicht klagte.“ (Brief vom 5. März 1939)
Er schlug vor, an unabhängige Intellektuelle wie Bertrand Russell und Roland Penrose heranzutreten. Aber Read muß auch weiterhin ablehnend geblieben sein, denn aus Orwells Plan wurde nichts. Er unterstützte Revolt!, das nach Ende des Bürgerkriegs auf Spain & the World folgte, und er scheint auch Antikriegsmaterial geschrieben zu haben. Zur Zeit des Münchener Abkommens schrieb er an Jack Common und bemerkte: „Ich wünsche mir, jemand würde meine Flugschrift gegen den Krieg drucken, die ich früher in diesem Jahr geschrieben habe, aber das wird selbstverständlich niemand tun.“ (Brief vom 12. Oktobe. 1938) Und später, in seinem Essay My Country Right or Left sagte er, er habe in seinem Kampf gegen Krieg „sogar Reden gehalten und Flugschriften dagegen verfaßt“ (Folios of New Writing, Herbst 1940). Eine solche Flugschrift konnte bis jetzt nicht nachgewiesen werden, obwohl sie Gerüchten zufolge in vervielfältigter Form in Umlauf gesetzt worden ist. Andererseits — in seinem Essay Not Counting Niggers argumentierte er gegen die Unterstützung der westlichen Demokratien in einem Krieg gegen Faschismus, da Imperialismus und Kapitalismus keiner Verteidigung wert seien, und er plädierte für „eine wirkliche Massenpartei, deren erste Anliegen sind, Krieg zu verweigern und das imperiale Unrecht wiedergutzumachen“ (The Adelphi, Juli 1939).
Aber all das wurde völlig überholt von der nächsten bedeutsamen Entwicklung in Orwells politischen Überzeugungen, die — folgt man dem Bericht in My Country Right or Left — über Nacht kam zur Zeit des Hitler-Stalin-Pakts im August 1939. Er sagte, er habe geträumt, der Krieg hätte begonnen, woraus er gelernt habe, „erstens, daß ich schlicht und einfach erleichtert sein sollte, wenn der lang gefürchtete Krieg begänne; zweitens, daß ich im Grunde meines Herzens patriotisch war, meine eigene Seite nicht sabotieren oder bekämpfen würde, daß ich den Krieg unterstützen, darin — wenn möglich — mitkämpfen würde“. Es erwies sich also im nachhinein für ihn als günstig, daß Read nicht überzeugt worden war, seine Antikriegskampagne zu unterstützen! Stattdessen leisteten die Anarchisten und Pazifisten (und einige revolutionäre Marxisten) ohne seine Hilfe Widerstand gegen den Krieg — und tatsächlich gegen seinen erbitterten Widerstand.
Nach 1939 verteidigte Orwell nie wieder den Anarchismus und griff ihn oft an. Während des 2. Weltkriegs hatte er keine Hemmungen, Anarchisten (und Pazifisten) als „objektiv pro-faschistisch“ hinzustellen, eine Bezeichnung, die ihn in Rage gebracht hatte, als sie von den Kommunisten gegen Anarchisten (und Trotzkisten) in Spanien benutzt worden war. Er erlaubte sich ganz besonders ausfallende Beschimpfungen in seinem gelegentlichen Brief aus London, den er zur Partisan Review, dem halbtrotzkistischen amerikanischen Magazin, beisteuerte. Das schlimmste Beispiel erschien in der Ausgabe vom März/April 1942. Er schloß nicht nur Anarchisten und Pazifisten in den, wie er es nannte, „linken Defätismus“ ein, sondern gab auch eine Darstellung des halbanarchistischen britischen Magazins Now, die suggerierte, es handle sich um eine pazifistisch-faschistische Front, und er behauptete sogar: „Julian Symons schreibt in einem vage faschistischen Stil.“ Heftige Erwiderungen von George Woodcock, dem Herausgeber von Now, und Alex Comfort folgten in der Ausgabe vom September/Oktober 1942. Charakteristischerweise freundete sich Orwell mit ihnen und mit Symons an; aber er hatte einen weiteren bösen Zusammenstoß mit Comfort im Juni 1943 in der Tribune: die beiden tauschten satirische byronische Stanzen aus, wobei Orwell Comfort beschuldigte, „den Nazi-Hintern küssen“ zu wollen!
Er fuhr fort, Anarchismus auch viel allgemeiner anzugreifen. In einer Rezension eines Buches von Lionel Fielden, das für indische Unabhängigkeit eintrat (erschienen in Horizon, September 1943), brachte er einen Hinweis unter auf das, was er „Salon-Anarchismus — die Forderung nach dem einfachen, auf Dividen den gegründeten Leben“ nannte. In seiner Broschüre über The English People (1944 geschrieben, aber erst 1947 veröffentlicht) merkte er an, daß „Engländer in großer Zahl jede Überzeugung ablehnen werden, deren vorherrschende Merkmale Haß und Illegalität sind“ — wozu er Anarchismus ebenso wie Kommunismus, Faschismus und Katholizismus zählte. In einem späteren Brief aus London an Partisan Review (Winter 1945) zählte er Anarchisten zu den Mitverantwortlichen dafür, daß, „besonders auf der Linken, politisches Denken eine Art von Masturbationsphantasie ist, in der die Welt der Tatsachen kaum eine Rolle spielt“. In einer Rezension des Sammelbandes von Essays Herbert Reads A Coat of Many Colours wand er ein, daß Reads Version des Anarchismus „die gewaltige Frage vermeidet: wie lassen sich Freiheit und Organisation miteinander vereinbaren“ und daß, „außer es gibt einen unvorhersagbaren Wandel in der menschlichen Natur, Freiheit und Effizienz in entgegengesetzte Richtungen ziehen müssen“ (Poetry Quarterly, Winter 1945).
Nach dem Krieg verfaßte er zwei größere Essays, in denen er ernstzunehmende Kritik am Anarchismus vorbrachte. In Politics versus Literature: An Examination of Gulliver's Travels (Polemic, September/Oktober 1946) nennt er Jonathan Swift „eine Art Anarchist“ — einen „konservativen Anarchisten“ sogar, wie Orwell sich selbst einmal bezeichnet hatte —, „der Autorität verachtet, während er an Freiheit nicht glaubt“; und er fügt hinzu, das vierte Buch von Gullivers Reisen sei „ein Bild einer anarchistischen Gesellschaft, nicht durch Gesetz im gewöhnlichen Sinne regiert, sondern durch die Gebote der 'Vernunft', die freiwillig von jedermann akzeptiert werden“. Er kommentiert, daß „dies sehr gut die totalitäre Tendenz illustriert, die explizit in der anarchistischen oder pazifistischen Vision von Gesellschaft enthalten ist“ (explizit? meint er etwa implizit?); und er fährt fort:
„In einer Gesellschaft, in der es kein Gesetz und theoretisch keinen Zwang gibt, ist der einzige Schiedsrichter in Verhaltensfragen die öffentliche Meinung. Aber öffentliche Meinung ist, infolge des ungeheuren Triebes zur Konformität bei Herdentieren, weniger tolerant als jedes Rechtssystem. Wenn menschliche Wesen von 'Du sollst nicht' regiert werden, kann das Individuum ein größeres Maß an Exzentrik praktizieren; wenn sie angeblich von 'Liebe' oder 'Vernunft' regiert werden, ist es unter unablässigem Druck, sich zu benehmen und zu denken in exakt der gleichen Art und Weise wie jeder andere.”
In dem Artikel Lear, Tolstoy and the Fool (Polemic, März 1947), der weniger Tolstois Ansichten über Shakespeare beinhaltet als vielmehr Orwells Verständnis von Tolstoi, bewertet er Tolstois religiöse Verbindung von Anarchismus und Pazifismus nach dem gleichen Muster:
„Tolstoi verzichtete auf Reichtum, Ruhm und Privileg; er schwor der Gewalt in allen ihren Formen ab und war bereit, dafür zu leiden; aber es ist nicht leicht zu glauben, daß er dem Prinzip des Zwanges abschwor oder zumindest dem Verlangen, andere zu zwingen... Der Unterschied, der wirklich ins Gewicht fällt, ist nicht der zwischen Gewalt und Gewaltlosigkeit, sondern der zwischen dem 'Appetit-nach-Macht-haben' oder 'Nicht-haben' .“
Orwell betont nachdrücklich: „Es gibt Leute, die von der Schlechtigkeit von Armeen und Polizei überzeugt sind, die aber nichtsdestoweniger in ihrer Zielsetzung viel intoleranter und der Inquisition ähnlicher sind als der Normalmensch, der glaubt, unter bestimmten Umständen sei es notwendig, Gewalt zu gebrauchen“; und er fügt hinzu, daß „Weltanschauungen wie Pazifismus und Anarchismus, die an der Oberfläche einen völligen Verzicht auf Macht zu implizieren scheinen, diese Geisteshaltung eher ermutigen“.
Es ist schwer zu sagen, ob Orwell das wirklich auch glaubte, dabei vergaß, wie er selbst seinen Lebensunterhalt und eine Reputation daraus machte, sich wieder und wieder über die öffentliche Meinung hinwegzusetzen, und dabei außerdem den wesentlichen Unterschied ignorierte, der zwischen dem Besitz autoritärer Anschauungen in der Theorie und dem Besitz von Macht, sie in die Praxis umzusetzen, liegt. Schließlich hat die intoleranteste und totalitärste Ideologie oder Gemütsart solange keinen Effekt, bis jemand in der Lage ist, Befehle nicht nur zu erteilen, sondern sie auch befolgt zu bekommen. In seinen eigenen berühmtesten Büchern — Farm der Tiere und 1984 — ist das Schlimmste an der Tyrannei, die er beschreibt, nicht ihre Konformität im Bereich der Moral, sondern ihre physische Macht, und dasselbe war selbstverständlich auch wahr im Falle Nazi-Deutschlands und des kommunistischen Rußlands. Orwell läßt sich nicht als einer der ernsteste Feinde des Anarchismus betrachten.
Tatsächlich ist vielmehr das Merkwürdige, wenn nicht gar Charakteristische an Orwell, daß er einer der besten Freunde der Anarchisten war, selbst wenn er gerade den Anarchismus an sich attackierte. Zu genau der gleichen Zeit, als er sie „objektiv pro-faschistisch" nannte, in den schlimmsten Tagen des 2. Weltkriegs, scheute er keine Mühe, ihnen zu helfen. Während er von 1941 bis 1943 als Korrespondent in der indischen Abteilung der BBC arbeitete und dann von 1943 bis 1945 als Literaturredakteur der Tribune tat er sein Bestes, eine möglichst große Vielzahl von Meinungen zu publizieren; das betraf auch Anarchisten und Pazifisten, und Anarchisten zählten zu seinen engsten Freunden. Crick bemerkt zu dieser Periode: „Er akzeptierte Anarchismus nicht im Prinzip, aber er hatte als ein Sozialist, der jeder Art von Staatsmacht mißtraut, eine spekulative und persönliche Sympathie zu Anarchisten“ — wie Crick selbst, läßt sich hinzufügen. Zum Ende des Krieges, als Orwell und seine erste Frau ein Kind adoptierten, begann dann Vernon Richards, der immer noch in der Gruppe tätig war, die War Commentary, den Nachfolger von Spain & the World und Revolt!, herausbrachte, die berühmte Serie von Fotos aufzunehmen.
In der Tat gibt es eine Anekdote, daß diese Gruppe, Freedom Press, tatsächlich Farm der Tiere hätte publizieren können. Crick gibt die Version wieder, die George Woodcock erzählte; daß Orwell das Buch, nachdem es von Victor Gollancz, Jonathan Cape, Faber & Faber und möglicherweise anderen Verlegern abgelehnt worden war, über Woodcock der Freedom Press angeboten hätte; es sei aber abgelehnt worden, weil zur Gruppe „viele kriegführende Pazifisten“ gehört hätten. Crick erwähnt, daß Vernon Richards „unerschütterlich daran festhält, daß es nie angeboten worden ist“, aber merkt an, daß „er [V. R.] zur fraglichen Zeit im Gefängnis war und möglicherweise nicht davon unterrichtet wurde“. Da sich das Ganze im Juli 1944 abgespielt haben muß, bevor das Buch von Secker & Warburg (die Homage to Catalonia publiziert hatten) akzeptiert wurde, und da Richards erst einige Monate später eingekerkert wurde, ist es wahrscheinlicher, daß Richards recht hat. Woodcock verweist nur auf die feindselige Haltung von Marie Louise Berneri. Die überlebenden Mitglieder der Freedom Press jener Zeit stimmen darin überein, daß das Buch ihnen ganz sicher nicht angeboten worden ist und daß es andernfalls sicherlich nicht abgelehnt worden wäre. Es gibt auch die Version, das Buch sei beinahe von Paul Potts publiziert worden, dem Dichter, der ein eigenes Verlagsunternehmen besaß, und es sieht zumindest danach aus, daß Orwell ernsthaft daran dachte, es auf eigene Kosten zu produzieren. Aber es wurde schließlich 1945 von Secker & Warburg verlegt und machte ihn berühmt.
Es gibt eine ähnliche Anekdote, die auch ihren Ursprung bei George Woodcock zu haben scheint. Crick übernimmt sie aus einem Brief, den Orwell 1946 an Dwight Macdonald, den amerikanischen Journalisten, schickte, wie folgt:
„Als Königin Elisabeth [die Königinmutter], deren literarischer Berater Osbert Sitwell war, im November einen königlichen Boten um ein Exemplar zu Secker & Warburg schickte, fand der sie völlig ausverkauft und mußte mit Pferd, Wagen, Zylinder und allem zum anarchistischen Freedom Bokshop in Red Lion Square fahren, wo George Woodcock ihm ein Exemplar gab.”
Die überlebenden Mitglieder der damaligen Freedom Press erinnern sich vielmehr, daß es ein Verlagsbote war, der das Buch holen kam. Aber es ist eine schöne Anekdote, selbst wenn es nicht mehr als eine Anekdote ist — obwohl sich im übrigen der Freedom Bookshop selbstverständlich in Red Lion Street, nicht im Red Lion Square befand.
Was sicherlich nicht nur eine Anekdote ist, ist Orwells spätere Unterstützung von Anarchisten. Als Ende 1944 und Anfang 1945 bei der Freedom Press eine Razzia durchgeführt und vier Herausgeber von War Commentary des Versuchs angeklagt wurden, „die Moral von Mitgliedern der Truppen Seiner Majestät“ zu untergraben, schrieb er in Protest dagegen nicht nur Artikel und unterzeichnete Protestbriefe, sondern wurde auch Vizepräsident des Freedom Defence Committee, das gegründet wurde, da damals der National Council for Civil Liberties kommunistisch kontrolliert war. Die Geschäfte des FDC wurden von George Woodcock geführt, der überliefert hat, daß Orwell, dessen Krankheit damals immer schneller fortschritt, außer seinem Namen auch Zeit, Geld und eine Schreibmaschine beisteuerte. Später geriet er dann in ambitiösere Bemühungen, mit Bertrand Russell und Arthur Koestler eine Liga für Menschenwürde und Menschenrechte (League for the Dignity and Rights of Man) zu gründen, aus der nichts wurde, obwohl einige der Ideen vom Congress of Cultural Freedom und Amnesty International aufgegriffen wurden.
Der entscheidende Punkt ist natürlich, daß Orwell aufrichtig an die Pressefreiheit — und Rede- und Versammlungsfreiheit — nicht nur für Leute glaubte, mit denen er übereinstimmte, sondern auch für solche, die von seinen abweichende Ideen vertraten. Das erstreckte sich nicht nur auf Anarchisten und Pazifisten, sondern auch auf Faschisten und Kommunisten. Aber er schrieb nie für faschistische oder kommunistische Blätter, wie er im Gegensatz dazu für Woodcocks Now und für Freedom, nach dem Krieg Fortsetzung von War Commentary, schrieb. Es ist nicht überraschend, daß Orwell, als das Freedom Defence Committee 1949 aufgelöst wurde, Freedom Press seine alte Schreibmaschine überließ (auf der, Gerüchten zufolge, Freedom immer noch getippt wird).
Ein letztes Ereignis verband Orwell mit den Anarchisten. Als er 1949, dem Jahr der Publikation von 1984, ein Jahr vor seinem Tod, so sehr schwer tuberkulosekrank war, brachte er seinen Adoptivsohn in der Nähe seines Sanatoriums in den Cotswolds unter. Crick berichtet, der Junge sei „unter die Obhut von Lilian Woolf, einer dreiundsiebzigjährigen Veteranin der britischen anarchistischen Bewegung, die in der nahegelegenen Anarchisten- und Handwerkerkolonie Whitelands lebte", gestellt worden. (Lilian schrieb ihren Namen Wolfe, und die Kolonie heißt Whiteway, aber was soll's!) Wie schön zu wissen, daß Orwell am Ende seines Lebens von einer Anarchistin und Pazifistin geholfen wurde — eine vollkommene Ironie zum Schluß des Falls Orwell und die Anarchisten. Für uns ist selbstverständlich nicht von Bedeutung, was Orwell über diese und jene Art von Anarchismus sagte oder für diese oder jene Anarchisten tat, sondern was er meinte, als er zu seiner fundamentalen politischen Position die Form von Sozialismus wählte, die auf die Überwindung von Tyrannei und die Etablierung von Gerechtigkeit und Freiheit gegründet ist, und was er in belletristischen und satirischen Arbeiten über die Implikationen einer solchen Position sagte. Er war allerhöchstens für die Anarchisten ein Mitläufer, aber er war einer der besten.
[1] Werkausgabe in 11 Bänden in Kassette, Diogenes Verlag, Zürich, 1983.
[2] Als die neuesten Arbeiten über George Orwell sind u. a. zu nennen: D. Hasselbach (Hrsgb.), Or-wells Jahr, Ullstein Verlag, Berlin, 1984; Lutz Büthe, Auf den Spuren George Orwells. Ein soziale Biographie, Junius Verlag, 1984.
[3] Inzwischen wurden auch Artikel im BBC-Archiv gefunden, die Orwell als Korrespondent in Indien für die BBC verfaßte.
[4] Über die konterrevolutionäre Politik der spanischen Kommunisten s. u. a.: Rudolf Rocker, Die Spanische Tragödie, Berlin 1976; Heiner Koechlin, Die Tragödie der Freiheit — Spanien 1936-1937, Berlin 1984. Eine sehr ausführliche Bibliographie zum Thema Spanische Revolution befindet sich in: Fernando Arrabal, Kloaken der Macht — Briefe, Essays, Einakter, Berlin 1982. (Alle Bücher sind im Karin Kramer Verlag erschienen.)
[5] „Was Catalonien betrifft, so hat die Säuberung von den trotzkistischen und anarcho-syndikalistischen Elementen bereits eingesetzt, und sie wird dort mit derselben Energie durchgeführt werden wie in der UdSSR.“ (Prawda, 17. 12. 1936), in: Rudolf Rocker, Die Spanische Tragödie, a. a. 0., S. 58.