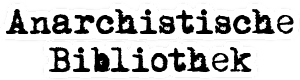Max Nettlau
Luigi Galleani (1861–1931)
Das Jahr 1931 brachte die Morgenröte in Spanien, dann aber, bevor die Völker erwachten und sich den Schlaf aus den Augen rieben, machten verhängnisvolle Kräfte aus dem schönen Frühjahr den Beginn eines grausamen Vernichtungsjahres, dessen Schrecken noch dieses Jahr fortwirken. Das vorige Jahr raffte viele junge Kräfte unter uns dahin, in Spanien, Portugal, Italien, Kuba und Südamerika, und auch eine Reihe der bestbekannten Älteren und Ältesten. Da starb François Dumarthay, gleichaltrig mit Kropotkin (geb. 1842), der erste neuere Verkünder des anarchistischen Kommunismus (1876) und Kropotkins nächster Genosse in der Genfer Zeit, 1879 bis 1881. Ferner Dr. José Garcia Vinas (geb. 1848), einer der intimsten Militanten der spanischen Internationale, und Alianza, 1870 bis 1880, dann der alte Brocher (geb. 1850), in London und Lausanne als engster Genosse, auch als Erzieher und Freidenker über fünfzig Jahre tätig, Emile Pouget, dem, neben Pelloutier, der französische Syndikalismus der Jahre 1895 bis 1908 geistig das Allermeiste verdankt, Teresa Claramunt, einst die spanische Louise Michel genannt, und nun starb auch noch am 4. November Luigi Galleani, der hinreißendste italienische Redner und literarische Propagandist. Malatesta, der am 4. Dezember 1931 78 Jahre alt wurde, nennt ihn „relativ jung noch, er war erst 70 Jahre alt. Er hätte gewünscht, ganz wie ich, lange genug zu leben, um wenigstens die Morgenröte besserer Tage zu sehen. Das Schicksal wollte es anders. Was tun? Man muß hoffen, daß Junge kommen und die Alten ersetzen, die fortgehen...“ Solchen Jungen soll hier von Galleani erzählt werden, wie neulich von Pouget.
Denn die Abgründe, welche die Reaktion in unserer Zeit öffnet, um den Fortschritt aufzuhalten, haben auch Galleani von der heutigen Generation getrennt. Im „befreiten“ Nachkriegseuropa ist man wieder in Staaten eingeschachtelt wie im Mittelalter, und für Anarchisten gibt es noch engere Zwingburgen innerhalb der Staaten — für Kropotkin das Städtchen Dmitrow, für Malatesta Rom, für Galleani gab es seit 1919 meist den Kerker, die Deportationsinsel oder das entlegene Bergdorf, wo er sterben durfte, das einzige in Italien noch vorhandene Menschenrecht.
Luigi Galleani, geboren 1861 in Vercelli im nördlichen gebirgigen Piemont, stammte aus einer bürgerlichen Familie, machte klassische, dann juristische Studien in Genua und Turin und war, frühzeitig Republikaner, einer der kühnsten und lebhaftesten der radikalen Turiner Universitätsjugend, dem eine glänzende juristische und politische Karriere offengestanden hätte. Er schritt aber im Alter von etwa zwanzig Jahren zum Anarchismus vor, und seinem Temperament entsprach, daß er dann auch nicht einmal als Verteidiger sich dem Staats- und Gesetzapparat äußerlich anpassen wollte, wie dies anarchistische Advokaten, wie Merlino, Gori, Luigi Molinari usw., taten, deren soziale und libertäre Plaidoyers einen wertvollen Teil ihrer Propaganda bildeten. Er wurde zunächst ein streitbarer Journalist in seinem Heimatsort, hatte Verurteilungen, auch Duelle mit den Offizieren der Garnison, dann lebte er in Turin, wo er als Mitarbeiter des anarchistischen „Proximustuus“ (Dein Nächster; vom B. September 1883 -ab) und Redakteur der „Gazzetta Operaia“ (Juni 1887 bis März 1888), als „Nuova Gazzetta Operaia“ (Neue Arbeiter-Zeitung; März 1888 bis September 1889; zusammen 92 Nummern) genannt wird, auch als Mitarbeiter am „Combattiamo!“ (Kämpfen wir!) und dem „Nuovo Combattiamo!“ (seit November 1887 bis 1890) in Genua.
Die norditalienische Internationale, seit 1871 besonders von Mailand und Turin aus einige Verbreitung findend, konnte nicht in dem Grade wie die von Toskana, der Romagna, Neapel usw. in dem reichen Menschenmaterial der nationalen Kämpfer der Sechziger, den Garibaldianern usw., schöpfen und kam in den industriellen Städten vor allem in Kontakt mit Arbeitermassen, die an der Besserung ihrer ökonomischen Lage direkt interessiert waren. Darum gewannen hier Legalitäre und Reformisten die Oberhand, aber auch ökonomische Revolutionäre, die nur den Arbeiterkampf kannten und wollten und die den Politikern nicht über den Weg trauten. Von diesen wurden dann manche der anarchistischen Propaganda zugänglich, andere duldeten sie wenigstens, andere ließen sich zur Politik bekehren. Der italienische Partito Operaio (Arbeiterpartei), seit 1882 von Mailand aus gegründet, mit ähnlichen Organisationen anderer Gegenden, bildete 1890 die Partei der italienischen Arbeiter, in der immer noch Gruppen aller Art, Unterstützungsvereine, Genossenschaften, republikanische, sozialistische und anarchistische Arbeiterzirkel nebeneinander bestanden.
Galleani wurde so ein Arbeiterredner in erster Linie, dem internationalen Anarchismus damals wohl noch etwas fernerstehend, aber der beredteste direkte Agitator. Dann trieb ihn irgendeine Verfolgung ins Exil, vielleicht zuerst nach Genf, jedenfalls um 1889 nach Paris, wo er internationale italienische Genossen und manche der damals sich den Ideen anschließenden Studierenden verschiedener Länder genau kannte; letztere, sich an Merlino, Malatesta, Kropotkin, Reclus, der Révolte besonders inspirierend, waren ein bald durch Verfolgungen, Ausweisungen usw. zerstreuter kleiner Kreis tüchtiger junger Leute. Von Italienern bei Besprechungen, die kurz vor dem 1. Mai 1890 liegen müssen, nennt Galleani selbst einmal Malatesta, Merlino, Paolo Schicchi, Augusto Norsa, Giuseppe Consorti, Galileo Palla, Cipriani und andere. Nach dem 1. Mai (Merlinos Verhaftung) mußte auch Galleani Frankreich verlassen und war dann bald in Genf und mehrere Monate in Clarens, hei Elisée Reclus, der ihn zu Hilfsarbeit an der Vorbereitung der großen Geographie beschäftigte (siehe meine Biographie: Elisée Reclus, Anarchist und Gelehrter, 1928, S. 250).
Dies waren glückliche Monate im freundlichsten Verkehr mit Reclus, anregende Beziehungen mit der Jugend verschiedener Länder, anderen Flüchtlingen und den alten Internationalisten in Genf; manchmal stiegen auch einige auf einsame Berge zu praktischen chemischen Versuchen; Elisée Reclus sagte nichts dazu, lächelte nur beim Abschied und sagte: seid vorsichtig. Als er nach Paris übersiedelte, im Herbst, kam Galleani nach Genf, wo sich seine Freundschaft mit Jacques Gross befestigte, der ihm, mit Reclus, von allen ausländischen Freunden gewiß am nächsten stand, bis zu seinem Tode (1928). Als im November ein Plakat über die Hinrichtung der Chicagoer Anarchisten (11. November 1887) in Genf hergestellt wurde, wies der Schweizer Bundesrat sechs der militantesten jungen Flüchtlinge aus, darunter Galleani, der an die italienische Grenze gebracht und in der nächsten Bahnstation, Como, verhaftet wurde.
Er wurde schließlich freigelassen und hatte dann Schwierigkeiten, gleich wieder in die Schweiz hineinzukommen, wo am 4. und 5. Januar 1891 in Capolago, nahe der Grenze, der bekannte italienische geheime sozialistische Kongreß stattfand, den 86 Delegierte, alle antiparlamentarisch und, bis auf zwei, alle Anarchisten, besuchten, für Hunderte von Gruppen. Dies galt der Aktion für den 1. Mai 1891 und der von Malatesta seit seiner Rückkehr aus Argentinien, 1889, begonnenen Organisation des Partito socialista rivoluzionario anarchico Italiano. Galleani, der besonders vorsichtig sein mußte, durch seine Bewegungen nicht die Polizei auf die Spur des Kongresses zu bringen, konnte nur nach Lugano kommen; er erhielt eine wichtige Mission. „...Man hatte beschlossen, daß Cipriani zusammen mit ... (Galleani) eine große Reise für Propaganda und revolutionäre Vorbereitung machen sollten, von Piemont bis nach Sizilien, mit dem besonderen Zweck, das Terrain zu untersuchen, die ernstesten und tätigsten Genossen zu sondieren, eine feste Kette aus ihnen zu bilden, die dann bei der ersten Gelegenheit von Nutzen sein sollte: aber diese Arbeit, die die besten Früchte gegeben hätte, blieb aus den gewohnten ökonomischen Ursachen nur ein Bruchstück ...“ (20. April 1918.) Die römischen Ereignisse vom 1. Mai führten zu dem Riesenprozeß, der am 14. Oktober 1891 begann, aber Galleani war in denselben nicht verwickelt.
Die Jahre 1891, 1892 und 1893 waren nun für Galleani — von einigen Monaten Gefängnis im Frühjahre 1892 abgesehen — Jahre intensivster agitatorischer Tätigkeit in Norditalien. Er wurde schließlich Buchhalter einer Fabrik in Sampierdarena bei Genua, einer Fabrik, deren junge Besitzer, zwei Brüder, mit den Ideen sympathisierten, so daß er Verfolgungen gegenüber einen sicheren Rückhalt hatte. Er kam zu der internationalen sozialistischen Versammlung vom 12. April 1891 nach Mailand und lernte damals Pietro Gori kennen, den jungen Advokaten (geb. 1867) und elegantesten anarchistischen Redner. Dort sprachen er und Gori neben Filippo Turati, Anna Kulischoff, dem Republikaner Fratti, dem französischen Sozialisten Rouanet und anderen; der spanische Anarchist Pedro Esteve war auch zu diesem Meeting gereist, dessen Zuhörermasse zur Betrübnis der Sozialisten die anarchistischer Tagesordnung annahm.
Einige Monate später, im August, trug Gori auf dem Parteikongreß viel dazu bei, dass die sozialistische Majorität die Wahlbeteiligungsfrage wenigstens offenließ. Diese Verhältnisse drängten aber zu einer Entscheidung, die der Kongreß von Genua im August 1892 bringen sollte.
Schon einige Zeit vor diesem war bei einer Besprechung Gori an der Kongreßtaktik sehr interessiert, während Galleani, wie er selbst später schrieb, „schon damals der unnützen Teilnahme an Parteikongressen widerstrebte“. Beide nahmen am Kongreß teil, der zur Sezession der Minderheit der politischen Sozialisten führte; die von Gori versuchte Zusammenfassung der Anarchisten und der die Wahltaktik ablehnenden Arbeitervereine kam aber auch nicht zustande. Malatesta, nach seinen Bemerkungen in „La Révole“, 17. September 1892, stand der Taktik von Gori näher als den Empfindungen von Galleani, in dem Sinne, daß auf ein Propagandamittel (auch als Minderheit in einer Organisation) nicht verzichtet werden sollte. Von nun ab verschärfte sich wohl Galleanis Agitation in Oberitalien, da jede Parteibindung entfiel, und begegnete auch größeren behördlichen Hindernissen, bis er im Januar 1894 verhaftet wurde und sein freies Wort in Italien ihm eigentlich für immer abgeschnitten wurde.
Galleani war, wie wir sahen, außerhalb des direkten Kontaktes mit der Internationale, mit der älteren Emigration (Malatesta, Merlino usw.) aufgewachsen und lernte dann in Genf und Paris den ausgeprägtesten anarchistischen Kommunismus im Sinne von Reclus und Kropotkin um sich herum allerseits kennen. Er war auch in dem industriellen, nicht politischen norditalienischen Milieu vor allem an Italien als einen bürgerlichen Einheitsstaat gewöhnt, während die südlichen Anarchisten das Land noch in Bewegung sahen, wie von 1814 bis 1870, und an neue Umwälzungen dachten, die durch ein Zusammengehen mit Sozialrevolutionären und Republikanern oder eine Volksrevolution mit dem hungernden Landvolk usw. doch vielleicht erzielt werden könnten.
Diese beiden Ideenreihen stellten Galleani auf die äußerste Linke des kommunistischen Anarchismus und in die Reihen der Gegner von Organisationsplänen und Koalitionen zu revolutionär-politischen Zwecken. Er kannte aber sehr gut die industriellen Arbeiter und war, bei allem Feuer, Piemontese, und so verfiel er nicht in die absolute Organisationslosigkeit (Atomisierung) und die unbegrenzte Formlosigkeit (Amorphie), die auch ihre Anhänger hatten. So vertrat er die reinste revolutionäre Anarchie kluger, nicht gänzlich impulsiver Art. Er war der Propagandist par excellence, und wo eine Aktionsmöglichkeit bestand, der zielbewußte Agitator, und er würde der voranstürmende Kämpfer gewesen sein, wenn die Möglichkeit einer gemeinsamen Erhebung sich ihm geboten hätte.
Ich sah ihn kaum eine halbe Stunde im ganzen Leben, habe aber besonders von Jauques Gross und anderen gemeinsamen Freunden sehr oft von ihm gehört. Im August 1893 gingen wir, einer der Genfer Ausgewiesenen von 1890, ein junger Armenier und ich, durch die Zentralschweiz in den Tessin, kamen nach Lugano, wo ich einen für mich historisch interessanten alten Internationalisten kennenlernte und deshalb zurückblieb; die beiden anderen fuhren nach Mailand zu Ettore Molinari, auch einem aus dem anarchistischen Milieu der Studierenden. In Mailand blieb ich wieder zurück und machte Bakunin-Studien in der Biblioteca di Brera; die andern fuhren nach Sampierdarena zu Galleani. Als ich zwei Tage später dort ankam, ging ich in die Fabrik und erfuhr dort von Galleani, die beiden andern seien, da sie mit ihm zusammen gesehen wurden, verhaftet worden. Das hätte ich auch haben können, wenn ich geblieben wäre, und es wurde mir geraten, abzureisen. Kurz darauf ging Galleani fort, um die sich immer an seine Fersen haftenden Spitzel mitzunehmen, und später führte mich einer der Fabrikbesitzer auf ruhigen Wegen zum Bahnhof, wobei mir der im Meer badende Galleani gezeigt wurde und die beiden Spitzel, die ihn beim Baden bewachten. Er hat uns auch gesehen und unscheinbar genickt, und so sah ich seine hohe, kräftige Gestalt wie eine Statue, und, was ich damals nicht dachte, zum letztenmal. Die beiden andern blieben zwanzig Tage im Gefängnis und wurden dann aus Italien ausgewiesen, der eine wahrscheinlich, weil er schon aus der Schweiz ausgewiesen war, der gänzlich unbeteiligte junge Armenier wegen gar nichts. Dieser ist später in seiner Heimat, wieder wegen gar nichts, sogar massakriert worden... In „La Révolte“, 4. November 1893, ist diese kleine Episode erzählt worden.
Im Januar 1894 wurde Galleani verhaftet und gegen ihn und 34 andere eine Gesinnungsanklage erhoben, das heißt, weil sie gemeinsam anarchistische Gesinnungen hatten, sollten sie eine Verbrecherbande bilden und nach § 248 des Codice Penale Italiano verurteilt werden, was auch geschah. Gori hielt damals eine vielverbreitete Verteidigungsrede. (Die Anarchisten und der Artikel 248 des italienischen Strafgesetzbuchs. New York, 47 S., in 12°; 1895.) Seit dieser Verurteilung im Juni 1894 blieb Galleani bis 1897 im Kerker, im ganzen 42 Monate, und wurde dann auf die Insel Pantellaria deportiert. Erst in den ersten Monaten von 1900 gelang ihm die Flucht über Tunis nach Ägypten, wo seine Lage auch eine sehr prekäre war; er hatte Typhus und mußte suchen, dem italienischen Konsul zu entgehen. „Endlich!“ — schrieb ihm Elisée Reclus, der, mit Gross, seine Flucht gefördert hatte —, „nun haben Sie die ,Klugheit der Schlange‘, von der uns die Bibel erzählt…“ Galleani wollte in Ägypten gleich eine Zeitschrift herausgeben, was ihm aber nicht möglich war. Der alte Genosse Icilio Ugo Parrini, dem seine Richtung besonders sympathisch war, wird ihm förderlich gewesen sein. Im Sommer 1901 erst kam er aus Kairo nach London und reiste bald darauf nach Paterson (New Jersey), wo er „La Questione Sociale“ redigierte, das seit dem 15. Juli 1895 erscheinende große Wochenblatt.
Nun hatte er wieder eine Zeit offener Agitation vor sich, als Redner und Schriftsteller, vor der zahlreichen italienischen Bevölkerung der östlichen Industriestädte. Ein lokaler Textilarbeiterstreik (April—Juni 1902) wurde aber am 18. Juni zu einem allgemeinen Streik erweitert, und Arbeiter besetzten damals auf friedliche Weise eine Reihe von Fabriken, und schließlich wurde der Streik gewonnen, und die später eintreffende Miliz stand keinem direkten Gegner gegenüber. Aber drei der Streikredner, Galleani, Mac Queen und R[udolf]. Großmann, wurde ein schwerer Prozeß gemacht (Oktober 1902) ; Galleani, der verwundet worden war, hatte aber vorher nach Kanada flüchten können. Mac Queen, ein früher in der englischen Provinz (Leeds) sehr tätiger Genosse, der nach dem Prozeß eine Zeitlang nach England zurückgekehrt war, trat später die Strafe an, wurde nach über vier Jahren Kerker todkrank entlassen und starb kurz darauf (9. November 1908). Das Urteil gegen R. Großmann, der nach England abreiste, wurde vier Jahre später von einer höheren Instanz aufgehoben. (K. S. in „Der Anarchist“, Wien, 30. Oktober 1927.)
Galleani kehrte schon im Frühjahr nach dem Prozeß geheim in die Vereinigten Staaten zurück und schrieb am 30. April an Reclus über die neue Wochenschrift, die dann vom 6. Juni 1903 ab bis zu ihrer Unterdrückung, 1919, von ihm redigiert wurde, wobei A. Cavallazzi Mitredakteur wurde. Sie erschien in Lynnn (Massachusetts) und später in Barre (Vermont), und in letzterer Stadt wurde Galleani am 30. Dezember 1905 verhaftet. Er wurde gegen Kaution freigelassen, und im Prozeß, am 24. April 1907, waren sieben Geschworene für die Freisprechung, fünf für seine Verurteilung, so daß ein neuer Prozeß hätte stattfinden müssen, da eine Einstimmigkeit fehlte. Dies ist nicht geschehen, und so war der Prozeß, dem Mac Queen zum Opfer fiel, erledigt.
Von den vielen glänzend geschriebenen Artikeln und Skizzen Galleanis ist manches durch Buchausgaben erhalten worden. Zunächst Faccia a Faccia col Nemico (Von Angesicht zu Angesicht dem Feind gegenüber). Gerichtschronik des militanten Anarchismus. Erster (einziger) Band von Mentana [Galleani], eine Ausgabe des Gruppo Autonomo von East Boston, Massachusetts; 507 S. in Gr.-8°, das im April 1915 erschienen zu sein scheint — eine Beschreibung vieler Prozesse — Passanante (1878) und Sophie Perovskaja (1881), Gallo (1886) und die Tötung des Ingenieurs Watrin in Decazeville (1886), der große Prozeß von Lyon (1883), der von Cyvoct (1883), Clément Duval (1887), den Anarchisten von Clichy (1891), Ravachol, Théodule Meunier, Etiévant, Vaillant, Emile Henry, Caserio (1894). Die Quellen sind sekundärer Art (das Buch von Henri Varennes usw.), aber die Darstellung ist effektvoll.
In der Vorrede wird bemerkt, man habe noch nicht „die Geschichte der Entwicklung des anarchistischen Gedankens begonnen, eine Geschichte, die, wenn sie nicht der der anarchistischen Aktion vorausgehen, diese, die zugleich der Tau und die Blüte der Idee war, wenigstens begleiten sollte.“ Die Gruppe wird die übrigen Prozesse sammeln „und zugleich Hand anlegen an die Herausgabe des Anarchismus (als) Gedanke, der die notwendige Ergänzung dieses Anarchismus (in) Aktion ist...“
Zunächst wurde ein Werk einer dritten Art vorbereitet, die Memoiren von Clément Duval aus den Deportationsinseln und vom Festland von Cayenne, das Martyrium der französischen Anarchisten seit 1886, das von Vittorio Pini usw., ein von Galleani bearbeiteter Text, der nach langen Bemühungen erschien als Clément Duval, Memorie Autobiografiche (Newark, New Jersey, Biblioteca de L’Adunata die Refrattari, 1929, 1047 S. in Gr.-8°) . Die Arbeit begann 1907, wurde 1917 von dem unglücklichen Salsedo fortgesetzt, dessen Todessturz aus dem Fenster eines New Yorker Polizeiamts am Anfang der Verfolgung gegen Vanzetti steht, und wurde 1929 beendet.
Hier sind wir bei den Märtyrern Sacco und Vanzetti angelangt, die zu Galleanis geistigen Schülern gehörten, und wenn nicht die amerikanische Justiz im Jahre 1919 die Cronaca sovversiva (Umsturzchronik) unterdrückt und Galleani und andere seiner Gruppe nach Italien deportiert hätte, wäre dieser Justiz gewiß einige Jahre später eingefallen, Galleani neben Sacco und Vanzetti auf den elektrischen Stuhl zu setzen. Unerschütterliche Treue für die Idee und Propagandafreudigkeit verband all diese Männer.
Eine größere Zahl biographischer Skizzen aus der Cronaca sind gesammelt in Figure e Figuri. Medaglioni (etwa: Gestalten und traurige Gestalten) in der gleichen Serie, 1930, 235 S. in 8°. Sympathische Bilder von John P. Altgeld, dem Gouverneur von Illinois, der das Justizverbrechen von 1887 aufdeckte, Zola, Berkman, John Turner, Blanqui, Reclus, Icilio Ugo Parrini (in Ägypten), Most, Carducci, Edmondo de Amicis, Nadar, Björnson, Tolstoi, Gori, Voltairine de Cleyre, Kropotkin, Bakunin, Antonio Cavallazzi (1915 gestorben), von der Cronaca, Scarlatti (dem Kerkeropfer des Florentiner Bombenprozesses), Proudhon, Robert Owen, Mazzini, Cipriani, Malatesta, eine wohlwollend forschende, aber tief diktaturfeindliche Studie über Lenin (1920) usw., — solche Bilder stehen neben den verachtungsvollen Skizzen einiger „großer Männer“, Renegaten usw. Wer über diese Gegenstände eine gewisse sichere Grundlage eigener Kenntnisse besitzt, wird viele ihm neue Einzelzüge und manches auf Galleanis eigener Erfahrung beruhende in dem schönen Bande finden.
Gegen kritisch durchdachte, aber dem Temperament nach kleinmütige Äußerungen von F. S. Merlino um 1905 richtete sich Galleani in der Cronaca wie ein Löwe auf, und diese lebhafte Studie ist das kleine Buch La Fine dell‘ Anarchismo? (Das Ende des Anarchismus?) . Ausgabe besorgt von alten Lesern der Cronaca Sovversiva, 1925, XI, 130 S. in Kl.-8°.
Endlich schrieb er Ende 1914 bis Anfang 1915 eine furchtbare Auseinandersetzung mit Kropotkin über die Kriegsfrage, die in der Biblioteca der Adunata vorliegt als Contro la Guerra. Contro la Pace. Per la Revoluzione Sociale (Gegen den Krieg. Gegen den Frieden. Für die soziale Revolution) ; 74 S. in 8°; o. J., (Januar 1929) .
Malatesta schrieb über den Neudruck von Das Ende des Anarchismus? in Pensiero e Volontà (Rom), 1. Juni 1926: ,,...Es ist wesentlich eine klare, heitere, beredsame Auseinandersetzung des anarchistischen Kommunismus nach der Kropotkinschen Auffassung: einer Auffassung, die ich persönlich für zu optimistisch, die Sache zu leicht nehmend (facilona), zu vertrauend in natürliche Harmonien halte, die aber deshalb nicht minder der größte bisherige Beitrag zur Propagierung des Anarchismus bleibt...“ Malatesta bemerkt noch, daß seine Ideen mit denen Galleanis über die Arbeiterorganisation übereinstimmen, nicht aber über die der Anarchisten. Dies sei aber nur eine Wortfrage, da auch Galleani, der von deren Organisation nichts wissen wolle, sich nicht gegen Assoziation, Entente (Verständigung), Einigung (unione) erklären würde, wie ja derartiges sich um seine Cronaca selbst herumgebildet und vielleicht zu sehr von einem einzigen Impuls (dem seinigen) abgehangen habe.
Ferner stellt Malatesta dem Verwerfen von Zukunftsbildern und der ausschließlichen Anerkennung der Aufgabe der Zerstörung seinen bekannten Standpunkt gegenüber, dass durch summarische Zerstörungen mit dem Schlechten und Unnützen auch Wertvolles zerstört würde, für das sich nicht gleich und nicht leicht ein Ersatz fände.
Galleanis Talent und Temperament wirkten sich eben nach dieser Richtung hin aus und waren einzigartig oder selten in ihrer Intensität, einer schönen, harmonischen, immer freudigen Kraft. Die ganze Welt hat gesehen, welche Summe von moralischer Kraft, klarer Intelligenz, revolutionärer Ausdauer und Treue Sacco und Vanzetti sieben Jahre lang unter den furchtbarsten Verhältnissen und bis zum traurigsten Ende zeigten: sie hatten das Zeug dazu in sich, gewiß, aber was ihnen etwa dazu noch gefehlt hatte, das hatten sie wohl meist Galleani zu verdanken, und sie sind nicht die einzigen.
Als er 1919 nach Italien zurückgeschleudert wurde, war Galleanis Gesundheit leider von Diabetes untergraben. Er wollte eine Vortragstour nach Mittelitalien unternehmen, konnte aber nur in der Gegend von Genua und Carrara einige Vorträge halten, als die Ärzte ihm Ruhe verordneten. Er gab 1920 in Turin 18 Nummern der Cronaca Sovversiva heraus, die meist verboten wurden, bis zum 20. Juli, wenn ich nicht irre. Er schrieb auch in Umanità Nova. Wegen des Artikels Soldato, fratello (Soldat, Bruder) wurde ihm ein großer Prozeß gemacht, in welchem berühmte Advokaten, ein Studienkollege von der Universität und der Sohn eines solchen mit Stolz und Freude für ihn sprachen. Er wurde Ende 1922 zu 14 Monaten verurteilt und fand, freigelassen, den Faschismus im Besitz der Macht. Er mußte ins Spital und lebte dann schwerkrank in Sori (Ligurien) bei einer Schwester in jener absoluten Zurückgezogenheit, die das faschistische Regime seinen noch im Lande geduldeten Gegnern aufzwingt.
Im Frühjahr 1927 wurde er bestraft, weil ihm die Adunata im Kuvert zugeschickt wurde, erst eine Geldstrafe, dann 10 Tage, dann behielt man ihn weiter im Gefängnis, und seine Verurteilung von 1894 wurde hervorgesucht, der die Deportation auf die Insel Pantellerra gefolgt war, der er sich durch die Flucht entzogen hatte – und darum mußte er, von der Provinzialkommission als „inoorregibile“ befunden, auf die Insel Lipari deportiert werden. Dort wurde er sehr bald zu einer Mussolini-Beleidigung provoziert, denunziert und nach Sizilien ins Gefängnis gebracht und zu 6 Monaten verurteilt, im Gefängnis der Deportationsinsel. Dann lebte er dort, bis er nach Jahren immer schwerer krank wurde. Es wurde ihm dann verboten, bei seiner Schwester in Sori, nahe dem Mittelmeer, zu wohnen, er mußte in das nördliche Vercelli, und schließlich gestattete man ihm in dem Bergdorf Caprigliola in der Provinz Carrara zu leben. Dort wohnen Pasquale und Zelmira Binazzi, alte Genossen, die seit 1903 in Spezia Il Libertario, ein großes Wochenblatt und unzählige Broschüren druckten, auch die Werke von Gori bis in den ersten Zwanzigern ihre Druckerei und alle Drucksachen von den Faschisten verbrannt wurden; und die beiden alten Leute selbst wurden seitdem hin und her deportiert und interniert.
Dort brachte Galleani 18 Monate zu, bis er am 4. November 1931, vom Schlag getroffen starb.
Von der Cronaca Sovversiva schrieb Galleani, wie [Luigi] Bertoni anführt: „…sie hat zahlreiche aufrichtige Freunde und zahlreiche erbarmungslose Feinde. Das ist ihr Stolz ...“
Dies gilt auch von Galleani selbst. So ist nun wieder ein freier Mensch zu Tode gemartert worden, von Henkern, die ihren Taten noch den Mantel eines Systems anhängen, des Faschismus, etwas, mit dem die früheren Henker wenigstens ihre Opfer verschonten. Aber Luigi Galleanis Geist lebt in vielen freien Menschen weiter, und sein Andenken ist uns lieb.