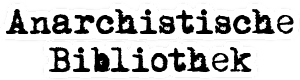Kevin Tucker
Klassenkampf, Kommodifizierung und die modernisierte Gesellschaft
Der Aufstieg und Untergang des Klassenkampfs
Industrielle und post-industrielle Arbeiter
Der Tod des Klassenbewusstseins
Die Effekte der Kommodifizierung
Die Gefahren der Industriellen Gesellschaft
Ist der Klassenkampf immer noch relevant? Die Reliquien zerfallender linker Bewegung hätten es immer noch gerne, dass wir uns an diesen Stückchen Geschichte festhielten, die schon lange überholt sind. Wie die anti-staatliche Publikation «Black Star North» behauptet: «Vorschlägen, dass Klassenkampf nicht mehr relevant für revolutionäre Theorie und Praxis sei, sollte mit hohem Verdacht begegnet werden. Diejenigen, die solche Behauptungen aufstellen, sind entweder naiv, fehlgeleitet oder aus der Mittel- / Oberschicht und nicht gewillt, sich mit ihrem Privileg auseinanderzusetzen.» [1]
Der Klassenkampf hat ohne Zweifel seinen Ursprung im Aufstieg der industriellen Gesellschaft. Die gesellschaftlichen Schichten durchdringen selbst den sozialen Umschwung, mit Betonung auf der Produktion von Nahrungsmitteln bis zur Spezialisierung innerhalb der unterschiedlichen Bereiche materieller Güter, die den idealistischen Reichtum unserer Zeit akzentuieren. Agrarische Gesellschaften hatten mit Sicherheit ihren Reichtum, doch die meisten Klassenkämpfer richten ihre Aufmerksamkeit auf das industrielle Zeitalter, das folgt (ein Detail, das immer ein ernstes Problem bei der historischen Analyse klassenkämpferischer Perspektive darstellen wird).
Der Aufstieg und Untergang des Klassenkampfs
Der Aufstieg des Klassenkampfs im industriellen Sinn, in welchem meistens Bezug darauf genommen wird, geschieht zeitgleich mit der zunehmenden Mechanisierung und Automatisierung. Ein dauernder Umschwung von menschlichen Energiequellen zu maschinellen. Die technologischen «Fortschritte», die während dieser Progression gemacht wurden, hatten grossen Einfluss auf die Stufe der Strenge wahrgenommen von der Arbeiterklasse (den Produzenten). Es bedarf keiner Erwähnung, dass dies von zunehmenden Profiten auf Seiten der Kapitalisten (der Besitzer) begleitet wurde. Es scheint extrem bedeutsam, die Unterschiede zwischen den Gesellschaften anno dazumals und heute zu erkennen. Die Konsumgesellschaft, in der wir heute leben, ist Welten entfernt von der industriellen Periode vergangener Jahre (natürlich existiert die selbe Situation immer noch, sie hat sich nur in der Grössenordnung geändert, wenn man bedenkt, dass der industrielle Prozess noch nicht völlig automatisiert wurde, doch dank unserer globalisierenden Wirtschaft in die sich ausbreitenden ‹Arbeitspools› der Völker der Zweiten und Dritten Welt verlagert wurde). Die riesige Menge an von der industriellen Produktion benötigten Arbeit und die kleinen Anteile von Reichtum, die für die Arbeiterklasse übrig gelassen wurden, machten Nuancen wie Supermärkte oder riesige Shoppingcenter quasi inexistent. Der Service-Sektor war also nur ein kleiner Prozentsatz der Arbeiter, verglichen mit unserer momentanen Gesellschaft, in welcher dieser Sektor den Grossteil geleisteter Arbeit ausmacht.
Dieser konstante Druck zur Arbeitsteilung in mundänere und bedeutungslose Positionen hat das Gesicht der Arbeitskraft von Grund auf verändert. Der Arbeiter ist in unserer modernen geschichteten Gesellschaft noch entfremdeter geworden, als die präfordistischen Fliessbandfabrikmodelle, von denen Marx gesprochen hat. Der Effekt, wiederum, hat einen noch grösseren Verlust individueller ‹Bedeutung› in einer Gesellschaft überflutet mit Arbeiterethik verursacht. Das ganze Szenario war sogar kaum etwas, das in Zeiten sozialen Widerstands vor dem Zweiten Weltkrieg in Betracht gezogen wurde, trotz den grossen Schritten in Richtung Modernisierung, die durch das 19. Jahrhundert hinweg bis zu dieser Zeit materiellen Reichtums – oder gewöhnlicherweise als ‹Wohlstandsgesellschaft› missverstanden [2] – gemacht wurden. Dies ist die Gesellschaft, in welcher wir (die privilegierte Erste Welt, woraus der Grossteil der Leserschaft dieses Essays bestehen dürfte) existieren. Es scheint erschreckend offensichtlich, dass wir uns zur post-industriellen Gesellschaft gewandelt haben (ein Schritt, welchen die sozialistischen Strömungen offensichtlich ignoriert haben).
Industrielle und post-industrielle Arbeiter
Der industrielle Fabrikarbeiter, der sich für einen Stundenlohn versklavt, ist ein Gebrauchsgegenstand. Das bleibt indiskutabel. Die Wirtschaft verwandelt uns alle in Prostituierte der Kapitalisten, die ihre Körper und Fähigkeiten bloss für den vorbestimmten wirtschaftlichen Wert (immer von den Bedürfnissen der Kapitalisten oder von den Bedürfnissen, die sie so clever für die sehnsüchtigen Arbeiter [was natürlich alles ist, das wir wirklich sind innerhalb der Religion «Wirtschaft»] gemacht haben, aus gesehen) vermieten. In der Periode, die aus Zeiten heftigen industriellen Zerfalls hervorgegangen ist, werden wir immer weiter zu Gebrauchsgegenständen entfremdet. Die intrinsischen kapitalistischen Interessen, Produzenten zu haben, sind anderer Natur, als die kapitalistischen Interessen an den Konsumenten, eine zarte Brut. Während letztere mehr Aufmerksamkeit und Triebbefriedigung brauchen (die Effekte von synthetischer und virtueller Befriedigung stellen an sich grosse Probleme dar), benötigt der industrielle Arbeiter die strikte Bestärkung seiner sozialen Stellung durch Dominanz im physischen Sinne. Dies ist zentral für das Verständnis unseres momentanen Dilemmas.
Der industrielle Arbeiter hat eine klare Funktion im Reich der Produktion. Die Arbeiterethik unserer Gesellschaft wurde in dieser Situation geboren und deswegen wird der industrielle Arbeiter in diesem Kontext einem grösseren Gefühl von Solidarität gegenüber anfällig sein. Etwas so inhärentes für unsere Leben zu tun, kreiert ein tiefes Gefühl von Wert eines grossen Teils der verschwindenden industriellen Arbeiterklasse (welche zur Wurzel des Klassenkampfs hochstilisiert wird), den ernsten Schlägen zum Trotz, die ihr durch die zunehmende Rolle von Spezialisierung und Automatisierung zugesetzt wurden.
Das fordistische Fliessbandmodell der Produktion war in sich selbst schon eine der ernsthafteren Formen der Modernisierung von Fabriken und dient als Beispiel für die durchschnittliche Stimmung der post-industriellen Gesellschaft (ausgezeichnet durch eine zunehmend wirtschaftlich geschichtete Gesellschaft mit stetig steigendem ‹Lebensstandart›, begleitet vom weiteren Auseinanderscheren von Ultrareich und dessen Bastard, Ultraarm). Dem wurde nur geholfen durch die Atmosphäre von durch Unternehmen assimilierten Gewerkschaften, was einem noch grösseren Schlag gegen die Arbeitersolidarität gleichkommt und die Ernüchterung kapitalistischer Fantasien nährt. [3]
Der industrielle Arbeiter war sich seiner Rolle als meist anerkannter Wertträger als Produzent der industriellen Gesellschaft wohl bewusst. Dies kreiert eine Kontingenz innerhalb der Arbeiterklasse, mit welcher man sich leicht identifizieren konnte und in die man sich noch einfacher einreihen konnte. Es ist klar ersichtlich, dass ein solcher Kontext der Arbeitersolidarität nur Aufschwung bringen wird, durch eine Einheit der Gemeinschaft der Ausgebeuteten. Der industrielle Arbeiter dieser Ära war mit Sicherheit ein Gebrauchsgegenstand des kapitalistischen Systems, doch in diesem System existierte eine Gemeinschaft, die ihr eigenes Wertesystem erschuf (obwohl wir sicherlich die Prämissen erkennen werden, die sie von ihren Alter Egos hereingetragen haben). Es existierte eine Definition und vielfältige Existenz der Arbeiterklasse; es war für jeden klar und offensichtlich. Bewegungen wie das Klassenbewusstsein waren kaum radikale oder wirtschaftlich randständige Bewegungen, sondern die tägliche Realität, wie sie überall ersichtlich war. Es dürfte keine Überraschung sein, dass sozialistische, kommunistische oder syndikalistische Ideologien in dieser Ära ihren Platz finden würden. Trotzdem sind Klassenkämpfer unserer Zeit nicht gewillt, davon abzulassen. Für manche bleibt die ‹Arbeiterklasse› ein konstanter, unfehlbarer Teil der Gesellschaft, sodass sie, egal was passiert, ihre Arbeitersolidarität haben werden. Es ist wahrscheinlich, dass so etwas nie existiert hat, aber jede radikale Theorie wird die Situation, in der sie sich befindet und womit sie sich wirklich befasst, irgendwann realistisch hinterfragen müssen.
Der Tod des Klassenbewusstseins
Die Ideale des Klassenkampfs (der Bewegung, in der eine bewusste Arbeiterklasse die Produktionsmittel übernehmen könnte und eine Gesellschaft basierend auf dem Grundsatz ‹jeder nach seinen Fähigkeiten, jeder nach seinen Bedürfnissen› aufstellen würde) sind natürlich kontextabhängig (um nicht zu sagen fehlerhaft, wie wir aus einer Vielzahl von Perspektiven im Nachhinein sehen können. Dies beinhaltet die ökologischen Effekte der industriellen Gesellschaft als Ganzes auf den Planeten und das Individuum, die Fehler von China und Russland, um die Wichtigsten zu nennen.)
Die grundsätzliche Stimmung der industriellen Ära ging mit dem Fluss der kapitalistischen Vision konstanten Fortschritts und des Werts im industriellen System (mit der offensichtlichen Ausnahme der Maschinenstürmer).
Die durchdringenden Auffassungen von ‹Fortschritt› und die Betonung auf die Produktionsebene und den Lebensstandart wurden als Norm angenommen. Die Arbeiterklasse war üblicherweise ein bisschen optimistischer, was die Verteilung angehäuften Reichtums anging, doch wenn man die Vertiefungsgebiete kapitalistischer Konzeptualisierung in Betracht zieht, scheint es, dass die Ergebnisse einer solchen Gesellschaft noch genauso tödlich wären wie unsere jetzige (ein Problem, mit dem wir uns in kommenden Abschnitten beschäftigen werden).
Die widersprüchlichsten Aspekte vom Klassenkampf und unserer momentanen Gesellschaft liegen hier. Die Zeiten haben sich drastisch geändert und die Attitüden des Klassenbewusstseins, die in der industriellen Gesellschaft eklatant waren, haben sich in den Seiten der Geschichtsbücher verloren. Wo es einst einen Punkt in der Gesellschaft gab, auf den sich eine Masse von Menschen beziehen konnte, existiert nun ein Konkurrenzfeld und die Linien sind alle verschwommen. Es gibt keine solide Arbeiterklasse, die sich mit den massenhaft kollektivierten Bewegungen, die den Klassenkampf verkörpern, identifizieren könnte. Auch wenn eine solche Gruppe existieren würde, es sind nur noch wenige Produktionsmittel übrig, die sie übernehmen könnten.
Es gibt zweifellos einen grossen Teil der Bevölkerung, mitten im Bauch der Bestie, der definitiv eine arme ‹Klasse› ausmachen würde. Die gesamte Auffassung von Arbeit wurde komplett aufpoliert, um sich der neuen Marktwirtschaft anzupassen, dem fast vollständig automatisierten Arbeitsplatz und dem stetig expandierenden Reich des Dienstleistungssektors. Es ist sehr unwahrscheinlich, eine solide Masse von Arbeiterklasse-Enthusiasten unter den Arbeitern in Supermärkten und Fabrikläden zu finden. Gibt es überhaupt Reste von Syndikalismus und Klassenbewusstsein? Ja, doch der grosse Teil von Marxisten und Klassenkämpfern sind nicht mitten im Mainstream, sondern in akademischen Universitätstaschen oder den abbauenden Überbleibseln von Fabriken. Dafür gibt es einen Grund, nämlich, dass die Ausbeutung andauert, aber dass es keine massive übereinstimmende Gemeinschaft mehr gibt, auf die sich diese Arbeiter beziehen könnten. Das gesamte Gesicht der Arbeit hat sich für immer geändert.
Die Effekte der Kommodifizierung
Die neuen Arten von Lohnsklaverei hatten tiefschürfende Effekte auf Zeitarbeiter. Die Zeiten, in denen man erwarten konnte, die nächsten 10, 20 oder mehr Jahre am selben Ort zu arbeiten, sind lange vorbei. (Obwohl, wer will das wirklich?) Die Jahrhunderte, in denen wir nach Produktivität, Ertrag und all den anderen ökonomischen Gleichnissen der Erniedrigung bewertet wurden, haben den Geist dazu verängstigt, in keinen anderen Begriffen mehr zu denken. Die Belohnung dafür, die ‹Wohlstandsgesellschaft› zu sein, war eine Reihe neuer Institutionen, die unsere Existenz noch mehr entfremden und vermitteln. Die Gegenreaktionen waren unvorhersehbar. So wie die Lösung, die zur Eliminierung von Kinderarbeit geführt hat (der Schulzwang), eine weitere Verderbung der Kindheit war; der wichtigsten Zeit persönlicher Entwicklung und Grenzziehung der eigenen Zukunft [4]. Nicht, dass Arbeit jemals als Alternative in Frage käme; die ‹zivilisierte› Lösung des eigentlichen Problem hat dem Image des Worts ‹menschenwürdig› kaum geholfen. Das Kind wird nun gezwungen, den Grossteil seiner Tage bis zum Alter von 16-18 Jahren (zumindest in den Vereinigten Staaten) eingesperrt in einem der effizienteren verfügbaren Werkzeuge zur Sozialisierung zu verbringen, dem Schulsystem.
In dieser Institution werden die Kinder vollgepumpt mit den ruhmreichen, selbstverherrlichenden Geschichten ‹ihrer› eigenen Herkunft und Widerwärtigkeiten. Vom Anbeginn der Tage, wenn sie dem ‹Treueschwur› (Pledge of Allegiance) durch hirnbetäubende Stunden der Konditionierung des wissenschaftlichen Geisteszustand ausgesetzt werden. Die Welt wird flach auf Papier ausgelegt, als die Karte des Imperiums, den simplistischen Gleichungen der Mathematiker, der akkuraten Sprache, der Etikette richtiger Domestizierung und dem Stolz, Teil der grossartigsten Nation zu sein, die jemals das Gesicht des flachen, durch Graphen dargestellten Planeten zieren durfte, ausgesetzt. Wie auch immer man es betrachtet, man wird entlassen als Produkt des kapitalistischen Systems. Der wohlrundige Konsument: der getunte, effiziente Arbeiter, der den Fortschritt vorantreiben soll.
Darin werden wir herausfinden, dass wir in unterscheidbaren sozialen Klassen landen. Dennoch, die subjektiven Klassen von heute unterscheiden sich sehr stark vom Gefüge sozialer Stände der industriellen Gesellschaft. Der Bürger in der post-industriellen Gesellschaft ist auch mit viel Fantasie nicht der klassenbewusste industrielle Arbeiter. Das Endprodukt des frühen Sozialisierungsmusters ist eifrig und ehrgeizig. Nicht mehr zufrieden sein mit einem bestimmten sozialen Stand, sondern immer auf- und vorausschauend in eine traumhafte Zukunft des Reichtums.
Ein Teil der heutigen Ökonomie zu sein ist weit von den geschlossenen Arbeiterreihen des Industrialismus entfernt und jeder, der jemals dieser Degradierung ausgesetzt war, weiss es. Die heutige Arbeiterklasse hat kaum irgendeine konkrete Orientierung oder Berufskategorie. Wenn wir versuchen, Linien zu ziehen, wer wo ist, werden merken, dass mehr Menschen zur Mittelschicht als sonstwohin gehören, Tatsache ist, dass die Struktur unserer Gesellschaft tatsächlich Schlupflöcher hat, die es für die ärmsten der Armen ermöglichen, super reich zu werden. In Wirklichkeit werden solche Vorkommnisse exzessive hervorgehoben, um ein solches Schlupfloch als Möglichkeit für alle darzustellen (während der Kapitalismus in Wirklichkeit immer seinen ‹Scheisshaufen› brauchen wird, den man nach Lust und Laune ausrauben kann, hauptsächlich bestehend aus der Umwelt, doch immer die Armen einschliessend [Armut an sich ist die Kreation eines solchen intrisischen kapitalistischen Bedürfnisses].)
In der modernisierten Gesellschaft gibt es keine Schleppleinen und das ist das Verkaufsargument des ‹freien Marktes›. Im Grunde genommen ist alles möglich (ganz sicher inklusive dessen eigener Zerstörung), doch die Realität, wie Klassenkämpfer immer hervorgehoben haben, ist, dass die gesamte Gesellschaft ‹ungerecht› ist. Das kapitalistische System ist abhängig von seinem Hauptmechanismus der Ausbeutung. Dies sollte für die meisten Leser eine kleine Überraschung sein, was an sich als eine Art Monument vergangener ‹Genossen›, die sich dem Klassenkampf verschrieben haben, angesehen werden kann (nicht, dass das irgend eine grosse Leistung gewesen wäre, in jedem aufkommenden Trend sickert etwas durch).
Die Idee fester, sozialer Klassen in der modernisierten Gesellschaft hat weniger Grundlage in der Realität, weil alle Linien in der Aufwallung kapitalistisch-utopischer Illusionen, besser verkauft als ‹UNSERE Zukunft›, verschwimmen, die die ‹allgemeine› Sicht überfluten. In fast jedem Aspekt unserer gegenwärtigen Lage hat die Kommodifizierung erfolgreich den fehlgeleiteten Vorstellungen Zutritt verschafft, dass wir alle reich sein können. In welcher Form auch immer diese Vorstellungen wieder auftreten; das Individuum in der Konsumgesellschaft sieht die Welt in Begriffen kapitalistischer Werte. Die Annahme, dass Essen auf Bäumen wachse, wird nicht für allzu wahr gehalten, eher für ein Hirngespinst, und grundsätzlich nicht für ein sehr wünschenswertes. Die neue Domestizierung (präferierte Versklavung durch die technologisch-industrielle Gesellschaft) hat uns beigebracht, das Nahrung nicht etwas ist, das frei existiert, sondern etwas ist, das frei in den vielen günstigen Supermärkten gekauft werden kann, die zu einer kranken Satire der Einfachheit geworden sind, Nahrung in der voragrarischen Gesellschaft zu finden.
Es gibt Ausnahmen und es wird sie immer geben. Die vielen ‹Revolutionäre›, die vom Saum unserer urbanen Lebensarten leben, sind auf diese Art zu ‹leben› genau so angewiesen, wie diejenigen, die ihr leben für einen Stundenlohn verkaufen. Und während die individuelle Übelkeit, in einer solchen Welt zu existieren, sich sicherlich klar unterscheidet, kann niemand eine massenübergreifende revolutionäre Strömung des Containerns und / oder Essen Klauens ernsthaft vorschlagen.
Im Grunde genommen ist es einfach so, dass unsere Gesellschaft in keinster Weise eine strikte Klassengesellschaft ist, egal, wie Akademiker und Soziologen das auslegen. Eine solche Überzeugung entspringt nicht der blossen Weigerung, sich mit dein eigenen ‹Privilegien› auseinanderzusetzen, sondern der offensichtlichen Beobachtung, dass unsere Gesellschaft auf eine vollkommen einzigartige Art gegliedert ist, obwohl wie in allen kapitalistischen Systemen die Reichen reicher werden und die Armen armer werden. Dies allein ist jedoch in keinster Weise irgendein Anhaltspunkt, dass Klasse der bestimmende Faktor für Aufstand oder Revolution sein wird oder sein sollte. Die Menschen wissen, dass sie gefickt werden, die Armen wissen, wer reich ist, aber es gibt keinen Anreiz, Teil einer sozialen Klasse zu sein. Dies ist der Grund, warum Klassenkampf seine massenübergreifende Zuwendung fortwährend verloren hat und nur mit noch mehr Zynismus belegt wird.
Der passive Nihilismus des Konsums hat mehr Pakete der Hilflosigkeit absorbiert und an uns wiederverkauft, als man sich vorstellen kann. Es ist stets möglich, diese domestizierte Mentalität zu durchbrechen, doch die Versuche, das durch eine überholte Bewegung des Klassenkampfs zu schaffen, hat sich kaum als eine wirkliche Lösung der Probleme gezeigt, die dieser Art zu ‹leben› innewohnen.
Man muss nur wenigstens eine kurze Zeit mit der Arbeiterklasse unserer Gesellschaft (die extrem Armen sind gehören hier einer anderen ‹Klasse› an) verbringen, um einzusehen, dass nur wenig Interesse daran besteht, als vereinigte Klasse, entschlossen, die Mittel der Produktion und Distribution zu übernehmen, aufzuerstehen. Die Geknechteten unserer Gesellschaft werden eher geneigt sein, sich dies als Antrieb, Wege zu finden, tiefer in die offensichtlich optimistische Selbstreflexion unserer Gesellschaft einzutauchen (durch die erforderliche kapitalistische Ermahnung zertrümmert, dass «wir es niemals so gut gehabt haben»), zu Herzen zu nehmen. Jemandes soziale Situation wird weniger als Lebensstil, als ein Indiz dafür betrachtet, wie viel Aufwand er für die ‹Verbesserung› seiner Situation betrieben hat. Dieses Szenario hat viele erfolgreich nur noch tiefer ins Innere des Ungeheuers gezerrt, statt radikale oder klassenbewusste Individuuen hervorzubringen. Die Schichtungen sozialer Stände haben die Entfremdung von kollektiven Bemühungen nur vorangetrieben im Tausch gegen eine blutdurstige Lust am Wettbewerb.
Die Gefahren der Industriellen Gesellschaft
Es gibt keine Zufluchtsstätte in einer idealisierten Welt des Industrialismus. Die Art dieser Zeit, zu denken (obwohl sie auch in unserer Zeit immer stärker wird) war auf Kollisionskurs mit den Desastern, die jede Gesellschaft aufsuchen, die solchen Druck auf die Umwelt und die Menschen dieser Kultur ausüben. Diese Art zu Leben, wie sie am besten durch unsere momentane Gesellschaft veranschaulicht wird, die auf jenem Weg fortgefahren ist, welcher lange vor der industriellen Ära angelegt wurde, hat einen verinnerlichten Mechanismus, welcher immer ihren eigenen Untergang bewirken wird. Und das ist der Aspekt fortwährenden Wachstums, der eine Konstante der zivilisierten Gesellschaft geblieben ist. Ein industrielles System basiert auf einem schnell verfügbaren und bestimmbaren agrikulturellen System, um für die neue, zentralisierte Art von System aufzukommen, die sich parallel zum Ganzen entwickelt hat.
Bei der Industrialisierung haben wir eine Situation, in welcher sich die typischerweise lebensnotwendigen Ressourcen, die sich auf die Beschaffung und Verteilung von Nahrung beziehen, von der Grundlage aller Vorkommnisse einer Gesellschaft zu einem Hilfsnetzwerk der aufkommenden neuen Grundlage, der Produktion, verschoben haben. Der Kapitalismus (ein durch die Zivilisation aufkeimendes Symptom jener) war schon immer abhängig von einem zentralisierten Verteilungssystem, das denjenigen im Mittelpunkt, dem Staat, Macht garantierte. Die Macht wurde in diesem Sinne nicht länger denjenigen überlassen, die für die blosse Produktion der Nahrung verantwortlich waren (die zunehmende Entwicklung neuer Technologien und Methoden, die Automation beinhalten und sich darauf abstützen, hat auf den heute Jahrhunderte alten Systemen von Zucht aufgebaut und ein neues Klima gross angelegter Manipulation hervorgebracht, um die Produktion zu steigern). In gewisser Weise wird das seit Generationen vorhandene Problem adäquater Nahrungsverfügbarkeit so gelöst (während die grossflächligen ökologischen Auswirkungen ausgeblendet werden, nur, um später wieder aufzutauchen um uns einen netten Arschtritt zu verpassen. Dies ist jedoch nicht etwas, das besagter Gesellschaft zwangsläufig unmittelbare Probleme verursachen würde). Das Problem dabei, diese Hürde zu überwinden ist, wie die Menschheitsgeschichte gezeigt hat, dass Überfluss an Nahrung einhergeht mit einer Ausdehnung der Bevölkerung. Das System ist darin mangelhaft, dass es keine Mittel gibt, die Population grundlegend zu beschränken. Die menschliche Lebensspanne in der Massengesellschaft, besonders in Bezug auf festgelegte Lebensstandorte, primär die gewaltig wachsenden industriellen Städte (ermöglicht durch zunehmende Möglichkeiten, Nahrung zu transportieren), wurde kenntlich gemacht durch das verbreitete Vorkommen von Krankheitsausbrüchen. In jeder anderen Gesellschaft wäre dies im Wesentlichen eine Methode, die Population in Schach zu halten. Die zivilisierte Antwort war wiederum, die Warnungen hartnäckig zu ignorieren, eine schnelle Lösung zu finden und mit vollem Tempo weiterzumachen (das Problem zunehmender Immunität gegen Super-Antibiotika sollte keine Überraschung sein, unsere moderne Medizin soll im oberflächlichsten, unmittelbarsten Sinne des Wortes ‹heilen›, wir finden den Verfall einer solchen Herangehensweise andauernd). Was das bedeutet, ist, dass das industrielle Leben ohne irgend eine Art eines massiv umgesetzten Limitationsprogramms, immer zum Umstand konstanten Wachstums verbannt sein wird (diese Programme, im geschichtlichen Sinne auch nur weitere Fehler, werden zu faschistoiden Tendenzen führen und die Wahrscheinlichkeit ihres Erfolgs sollte als genauso lächerlich bewertet werden, wie vergangene Versuche ‹aufzuräumen›). Ihren kostspieligen Effekten wurde grösstenteils anderswo Rechnung getragen. Es kann einfach keine nachhaltige oder zweckgemässe industrielle Gesellschaft geben (und wir sehen in zunehmendem Masse, dass es sie auch nicht geben sollte), welche die einzige idealisierte Gesellschaft als Folge des Klassenkampfs ist.
Die Revolte gegen die Arbeit
Es wird zunehmend klar, dass das Problem nicht ist, wer der Chef ist (sei es ein Individuum, eine Firma oder der Grossteil der ‹Arbeiterklasse›), sondern, dass wir überhaupt arbeiten müssen. Wir suchen immer nach dem ‹Weg des geringsten Widerstands›. Selbstverwaltetes Arbeiten ist immer noch Arbeiten, vor allem, wenn es die Dichotomie zwischen Produktion und Konsument bestärkt.
Jedes bisschen Arbeit, das wir verrichten, besonders diejenige, die verfügbar wäre, sollte der Klassenkampf bestrebt sein, Städte zu erhalten, fördert die Entfremdung, die mit dem Leben in einer synthetischen Realität einhergeht. Es gibt kaum noch etwas, das man tun kann, bei dem man einen ganzen Prozess von Anfang bis Ende sehen kann. Es gibt sehr wenig auszusäen und zu ernten (wir übersehen hier die Tatsache, dass keine grosse Pracht in dieser ermüdend mechanistischen Arbeit liegt, egal, was Bauernromantiker dazu sagen) oder sonstige nachhaltige Projekte in Städten. Je grösser die Gesellschaft, desto weniger ‹bedeutsame› Arbeit muss getan werden, doch es wird immer diese ‹kleinen Dinge› geben, die notwendig werden, um für das Ganze aufzukommen. Es wird also immer jemandes Aufgabe sein, diese Dinge zu produzieren und zu unterhalten. Wie auch immer man es betrachtet, es wird immer Arbeit sein. Es braucht nicht viel, sich die mögliche Freude kommunaler Nahrungssammlung und -produktion vorzustellen (am meisten, indem man sich die endlosen Möglichkeiten vorstellt, dies auf individueller Ebene zu tun), doch umso schwieriger ist es, sich das selbe Gefühl von Enthusiasmus und Freude beim Bauen von Traktoren oder bei alltäglicher Scheissarbeit vorzustellen, die ein solches Szenario zu ermöglichen hätte. Dies ist ein realistischer Kraftakt, den Klassenkämpfer heruntergespielt haben. Logischerweise wird die post-kapitalistische / post-zivilisatorische Situation voller Hindernisse sein, doch es scheint klar, das manche am einfachsten ganz ausgelassen werden, wobei das industrielle System eine der offensichtlichsten Optionen sein dürfte.
Das Übergangsdilemma
Es ist ganz und gar nicht unüblich, Klassenkampf als Mittel zum Ziel erwähnt zu hören. Wie auf den vorherigen Seiten allerdings gezeigt wurde, scheint das sehr fragwürdig ausserhalb gewisser industrieller Bereiche. Dies wirft Licht auf die gesamte Auffassung möglicher Übergänge von einer kapitalistischen / zivilisierte Ordnung, einen fortwährend wunden Punkt revolutionärer Theorie. Es scheint, als müsse man, um auch nur eine Vorstellung davon zu haben, was wahrscheinlich oder möglich wäre, ein detailliertes Szenario davon haben, wie man von da nach dort springen soll. Dieser Aspekt revolutionärer Theorie scheint, bestenfalls, beinahe vollkommen nutzlos als irgendeine Art von Praxis. Gescheiterte Revolutionen sind kaum je wegen fehlender Richtlinien gescheitert, ausserordentlich häufiger ist der Fehler, diese zu übersehen. In diesem Aspekt der Theorie werden wir am wahrscheinlichsten Spuren zivilisierten Denkens finden, die sich weigern, loszulassen. Aus dem ein oder anderen Grund wird die Möglichkeit einer spontan durchgeführten Revolution immer aufrechterhalten, doch darüber hinaus zu gehen wird kaum gross beachtet. Übergangstheorien werden aus allen Winkeln ausgerollt, doch wie kommt es, dass wir denken, diese Theorien würden funktionieren? In den meisten Fällen scheint es, dass diese ‹Stadien› eine Entwicklung, gewisse Laster des Kapitalismus abzuschütteln, seien. Beim Klassenkampf wäre dieses Laster die Idee einer herrschenden Klasse, der Bosse. Für anderen könnten diese Laster zentralisierende Strukturen der Regierung sein, es könnten Schulen sein, es könnte die Arbeit sein, doch was könnte wirklich utopischer sein, als der Gedanke, dass es ein massives, willentliches Tieferstufen zivilisierter Laster geben könnte? Wieso denken wir, wir könnten so weit kommen, doch immer noch dies und jenes ‹brauchen›, oder das etwas in den Menschen funken und sie zum Gruppendenken ‹erleuchten› könne?
Ich würde niemals behaupten, irgend ein spezielles oder eigenes Wissen zum Thema zu besitzen, doch es scheint, als ob es uns, wenn wir ernsthaft vorhaben, diesen Lebensstil zu beseitigen, viel besser tun würde, daran zu arbeiten, dies alles auf so viele Arten wie möglich zu dekonstruieren. Ich denke nicht, dass das Erfinden möglicher Szenarien, was passieren könnte, so erfolgreich sein wird, wie der Versuch, diese ganze Sache ausser Betrieb zu nehmen. Nicht, dass irgendjemand das alleine tun kann, doch wenn etwas, wieso nicht das? Wir leben in einer ziemlich abgefuckten Gesellschaft und es gibt jetzt wohl mehr Depression und Entfremdung als jemals zuvor, doch die Menschen werden sie nicht einfach immer aufgeben. Und was auch immer irgendjemand denkt, dass sie sich so an der kapitalistischen Gesellschaft festhalten, wird den unabdingbaren Untergang nicht abwehren. Es scheint offensichtlich, dass jede realistische revolutionäre Praxis darin liegen würde, das Unabdingbare zu begrüssen und daran zu arbeiten, den Einsturz nicht ganz so brutal zu machen, wie er sonst wäre. Ich bin der letzte, der sagen würde, dass viele transitorische Bemühungen sinnlos seien. Gewisse Handlungen, insbesondere Permakultur und andere Versuche, unsere Leben und Bioregionen zu ‹rewilden›, sind absolut lebenserhaltend für das Fortbestehen dieses Planeten und des Lebens darauf. Bewegungen, die versuchen, die Zivilisation davon abzuhalten, alles Wilde zu zerstören, spielen eine extrem wichtige Rolle. Bemühungen, den Menschen dabei zu helfen, die Entfremdung und Verderbung unserer vermittelter Leben zu überwinden, gehören zu den wichtigsten. Dies alles sind wichtige Dinge, doch wir sollten sie immer als das sehen, was sie sind: Dinge, welche den Schlag abbremsen und das Leben wieder bedeutsamer machen.
Kolonisierung und ihr Unbehagen
Das Problem, das üblicherweise von Klassenkämpfern übersehen wurde (oder in noch schlimmere Szenarien aufgenommen wurde), ist, dass die neuen Nationen, die in die globale Wirtschaft einbezogen wurden, sich wesentlich von unserer eigenen Situation unterscheiden. Damit der Klassenkampf überhaupt eine richtige Bedeutung für diejenigen haben kann, die im Prozess der Kolonialisierung stecken (trotz den Auffassungen von Massenmedien geschieht das für die meisten unfreiwillig), müssten sie sich tiefer in die kapitalistische Marktwirtschaft entwickeln und den Prozess der Industrialisierung fortsetzen (Marx und Engels sollen genau das vorgeschlagen haben). So bleibt der vorbestimmte Weg der Menschen, wie von den Kolonisatoren vorangetrieben, dass Fortschritt und Entwicklung der Sinn unserer Existenz seien. Sogar die angeblichen ‹Widerstandsbewegungen› in ‹Erstweltländern› geben den Kolonisierten keine Chance, autonom zu bleiben. [5]
Ist die oben genannte Situation per se ein Aspekt des Klassenkampfs? Nicht zwangsläufig, doch nichtsdestotrotz ist es ein Aspekt der grösseren Hinweise von Grenzen, die der Klassenkampf offenbart und er betont die minutiöse kontextuelle Basis, auf die er momentan aufbaut. Darauf baut der globalisierende Kapitalismus schliesslich auf und es ist ein weiterer Beweis für die Notwendigkeit einer totalen Revolution. Es existieren keine Produktionsmittel mehr, die übernommen werden könnten oder zumindest keine, welche irgendeine Art des Lebensunterhalts für Gesellschaften anbieten würden, ausser sie bleiben in der globalisierten Wirtschaft.
Es wird den Sweatshops einfach nichts bringen, von den Arbeitern übernommen zu werden, den Angestellten nichts bringen, die Läden zu übernehmen, den umgezogenen Stallburschen nichts bringen, die Ernte zu kontrollieren, den Arbeitern auf dem Bohrturm nichts bringen, einen Offshore-Bohrturm unter ihre Kontrolle zu bringen. Die Beispiele könnten fortgesetzt werden, doch sie alle zeigen auf eine Sache: die unabwendbare Fatalität dieser Art zu leben. Wenn wir uns darüber hinausbewegen wollen, muss es in eine grundsätzlich andere Richtung gehen, als in die, in welche wir uns jetzt bewegen.
Zeitgemässe Revolte
Um zu einem Abschluss zu kommen, kommen wir auf die ursprüngliche Frage zurück: «Ist der Klassenkampf immer noch relevant?» Es scheint, basierend auf einer breiter angelegten Analyse unserer heutigen Situation, dass der Kassenkampf relevant ist, doch dass seine Relevanz zunehmend unwichtiger für das Ende unseres heutigen ausbeuterischen Gefüges wird. Die Rolle des Klassenkampfs als historische und kumulative Bemühung wird für immer ausserhalb der Revolte gegen die Zivilisation stehen. Der Staat wird am meisten durch ein flüssiges Verändern der Situation als eine Form des Fortschritts erhalten, doch dies dient auch der Trennung von revoltierenden Bewegungen von ihren früheren Formen.
Mit diesem Verständnis müssen wir immer beachten, dass die sich verändernden Zeiten neue Perspektiven gegen die übliche Illusion, dass die Dinge für immer ‹besser als vorher› bleiben, erfordern. Auf diese Weise versucht die Totalität des zivilisierten Denkens jegliche radikalen Strömungen auszurotten, in einen Zustand von passivem Nihilismus zu neutralisieren und die Assimilation in die gesichtslosen Massen der Existenz voranzutreiben. Die Gegenwart, mit ihren heutigen Ständen und dem Widerstand gegen sie, wurde durch die Geschichte des Klassenkampfs geformt (zuoberst all jene, die durch die Vergangenheit zivilisierter Existenz hindurch versucht haben, die Megamaschine davon abzuhalten, zu expandieren). Ich persönlich werde täglich an diese Dinge erinnert, ersichtlich an der Eifrigkeit, mit der alle sich selbst Monumente errichten wollen. Hier im Westen von Pennsylvania, in Reichweite von Pittsburgh, kann man überall die historischen Injektionen sehen, die die Kapitalisten vorgenommen haben. Nicht weit von hier ist die Carnegie-Mellon-Universität, über der Stadt ist das Carnegie Science Center, in der ganzen Stadt findet man die zahlreichen Henry Clay Frick-Parks und -Krankenhäuser. Wer über die soziale Vergangenheit dieser Industrialisten und ihre tödlichen sozialen Bemühungen (Fricks Gemeinschaftsspenden und seine Pinkertons [6] geben hervorragende Beispiele ab) Bescheid weiss, kann nur eine noch grössere Solidarität für solche Klassenkämpfer wie Alexander Berkman [7] spüren, dafür, dass sie Stellung bezogen und versucht haben, das kapitalistische System (wörtlich) zu Fall zu bringen.
Die Revolte gegen dieses System wird immer kritische Analyse mit Betonung auf historischen Widerstand erfordern, doch wir können niemals bloss bei anderen verweilen. Wir sind Menschen mit einer Fülle an Herkünften, die eine subjektive Realität erzeugen. Es scheint offensichtlich, dass eine Revolte, die darauf ausgerichtet ist, das gigantische Biest der Zivilisation zu demontieren, anhaltende Anpassung an die gegenwärtige Situation erfordern wird. So sollte die Eingangsfrage vielleicht weniger die Relevanz des Klassenkampfs sein, sondern vielmehr die Rolle, welche die Klassengesellschaft in der Entstehung unserer heutigen Gesellschaft gespielt hat und wie das uns helfen kann, sie niederzureissen.
[1] «Towards an Understanding of Class Struggle in the 21st Century», Black Star North #3, St. 27
[2] siehe Clive Pontings «Green History of the World
[3] Siehe «Unions Against Revolution» – J. Zerzan & G. Munis
[4] Siehe Paul Shepards «Natur und Wahnsinn»
[5] Diese Debatte wurde jetzt seit einiger Zeit verfolgt und ein Teil davon wurde aufgezeichnet in «Marxism and Native Americans», bearbeitet von Ward Churchill
[6] Im Streik von Homestead setzte Frick zum Schutze der Streickbrecher in seinem Stahlwerk bewaffnete Hundertschaften der Pinkerton-Agentur ein.
[7] Berkman versuchte Frick zu ermorden, doch trotz drei Pistolenschüssen und zwei Stichen mit einem vergifteten Messer blieb er erfolglos und wurde wegen versuchten Mordes zu 22 Jahren Haft verurteilt.